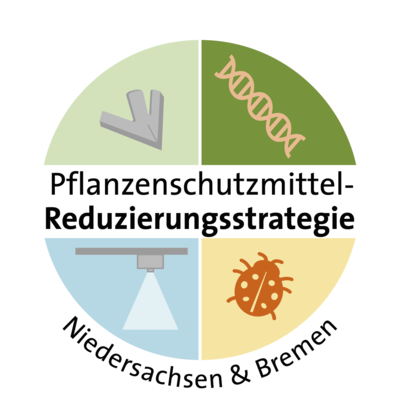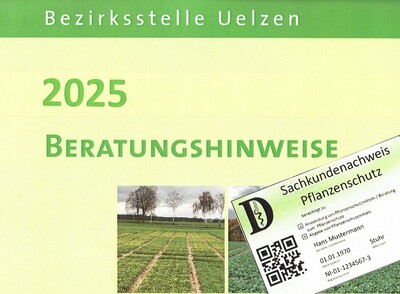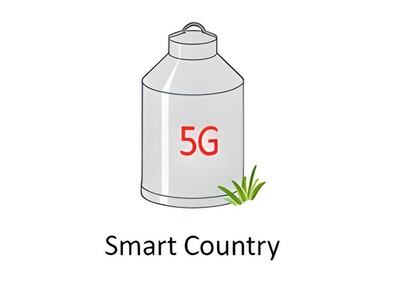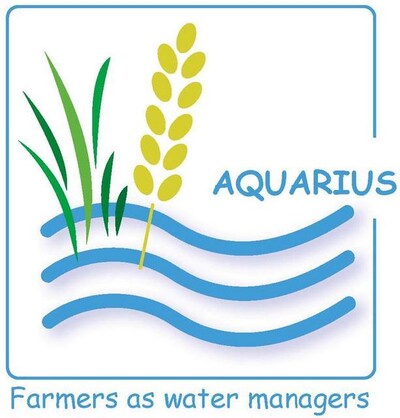Aufgrund seines hohen Schadpotenzials ist der Rapserdfloh (Psylliodes crysocephala) einer der Hauptschädlinge im Winterrapsanbau. Neben dem Lochfraß der Käfer an jungen Rapspflanzen kann insbesondere der Minierfraß der Larven zu Ertragseinbußen führen. Vor dem Hintergrund sich ausbreitender Insektizidresistenzen und der Vereinbarung zur Einsparung von Pflanzenschutzmitteln werden neue Ansätze zur Reduktion des Rapserdflohbefalls geprüft.
Zur Biologie des Rapserdflohs…

Anschließend beginnen sie mit der Eiablage in den Boden in Pflanzennähe. Die Eiablage kann sich in Abhängigkeit von der Witterung bis ins Frühjahr fortsetzen. Die aus den Eiern frisch geschlüpften Larven dringen in die Winterrapspflanzen ein und durchlaufen innerhalb der Pflanzen die Larvalentwicklung. Während sich der Schaden durch den Lochfraß der adulten Käfer in Grenzen hält und es nur bei kleinen und anderweitig gestressten Pflanzen zum Pflanzenverlust kommt, kann der Minierfraß der Larven u. a. durch gefrierendes Wasser in den Bohrgängen zu erheblichen Auswinterungsverlusten führen. Die voll entwickelten Larven begeben sich zur Verpuppung in den Boden, aus dem dann im Juni/Juli die Käfer schlüpfen.
Befallsüberwachung
Da der Schaden an den Winterrapspflanzen in direktem Zusammenhang mit dem Aufkommen adulter Rapserdflöhe und deren Larven steht, werden der Zuflug der adulten Käfer mit Hilfe von Gelbfangschalen sowie deren Fraßspuren an den jungen Rapspflanzen überwacht und nach Überschreiten des jeweiligen Bekämpfungsrichtwertes eine Behandlung mit einem Insektizid vorgenommen.
Durch die Befallsüberwachung und einer Bekämpfung nach den Bekämpfungsrichtwerten, was beim integrierten Pflanzenschutz zum Standard gehört, wird das stark jahresabhängige und oft auch regional sehr unterschiedliche Auftreten des Rapserdflohs berücksichtigt und es kann auf nicht erforderliche Insektizidbehandlungen verzichtet werden.
| Schädling | Zeitraum | Feststellung des Befalls | Bekämpfungsrichtwert |
| Rapserdfloh | Keimblatt bis 3-Blattstadium | Lochfraß | 10 % zerstörte Blattmasse |
| 4- bis 6- Blattstadium | Gelbfangschalen | > 50-75 Käfer in 3 Wochen | |
| Oktober - Dezember | Blattstiele aufschneiden / Austreibemethode | 3-5 Larven/Pflanze |
Neue Ansätze…
Neue Ansätze zur Reduktion des Erdflohbefalls werden auch aufgrund von sich ausbreitenden Insektizidresistenzen geprüft. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen einen reduzierenden Effekt von Stroh-Mulch-Auflagen (0,5 kg/m2) und Hafer-Untersaaten auf den Lochfraß und den Befall der Rapspflanzen mit Rapserdflohlarven (Winkler et al. 2023). Der Larvenbefall wurde dabei in beiden Behandlungen sowohl im Früh- als auch im Spätwinter signifikant um jeweils mindestens 65 % reduziert. Inwieweit auch eine geringere Strohmenge oder eine Mulchsaat ähnliche Effekte haben, bleibt zu prüfen.
Darüber hinaus bieten möglicherweise auch Sorten mit einem "Erdflohschutz" ein Potenzial zur Abwehr von Rapserdflöhen bzw. deren Larven. Laut Angaben eines Züchters soll es Sortenunterschiede beim Befall mit Rapserdflohlarven geben, wobei der Mechanismus, der zum geringeren Befall mit Rapserdflohlarven führen soll, auf ein erschwertes Eindringen der Erdflohlarven in die Pflanzen beruhen soll. Untersuchungen zum Befall verschiedener Winterrapssorten mit Rapserdflohlarven wurden 2023/24 im Rahmen des Projektes an zwei Standorten (Bremen, Göttingen) durchgeführt.
Bislang konnte an den Untersuchungsstandorten weder ein sortenabhängiger Befall mit Rapserdflohlarven noch ein positiver Effekt des Bockshornklees als Untersaat auf den Befall mit Rapserdflohlarven bestätigt werden. Insgesamt war der Befallsdruck sehr gering, der Bekämpfungsrichtwert von 3-5 Larven/Pflanze wurde an beiden Standorten nicht erreicht. Sollten sich die positiven Eigenschaften des Bockshornklees bzw. der Sorten mit "Erdflohschutz" bezüglich des Rapserdflohbefalls bestätigen, bleibt noch zu klären, ob die Ausprägung der jeweiligen Eigenschaft ausreicht, um eine Insektizideinsparung zu ermöglichen. Die Untersuchungen zu diesen neuen Ansätzen zur Reduktion des Rapserdflohbefalls sollen fortgeführt werden.
Winkler, J., G. Seimand-Corda, S. Leisch, S. Cook, O. Hensel & A. M. Kirchner, 2023: Reduktion des Rapserdflohbefalls durch Stroh-Mulch und Untersaaten. 63. Deutsche Pflanzenschutztagung – 26. Bis 29. September, Georg-August-Universität Göttingen; https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00055260/JKA_475_150.pdf
Bartlet, E., I. H. Williams, M. M. Blight and A. J. Hick, 1992: Response of the oilseed rape pests, Ceutorhynchus assimilis and Psylliodes chrysocephela, to a mixture of isothiocyanates. Menken, S. B. J., Harrewijn, P. and Visser, J. H. (ed.) Proceedings 8th International Symposium on Insect-Plant Relationships. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands. pp. 103-104