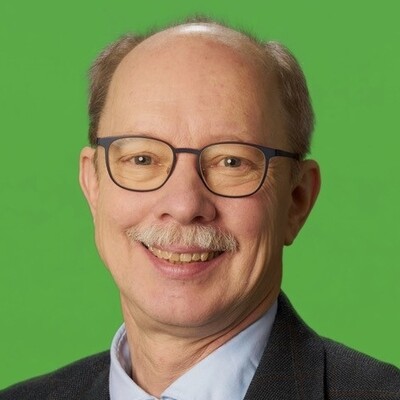
Dr. Jürgen Grocholl
Leiter Bezirksstelle Uelzen

Ausgangslage und Zielsetzung
Untersuchung neuer Ansätze zur Verringerung der Energiekosten bei der Feldberegnung mit dem Ziel eines verbesserten Managements von Wasser und Energie.
Projektdurchführung
Einerseits werden Möglichkeiten der Teilnahme am Strommarkt zur Nutzung von Niedriglastpreisen geprüft. Andererseits werden Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz der in der Beregnung eingesetzten Ernergie erforscht.
Die Durchführung des Projekts bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen oblag federführend Elisabeth Schulz.
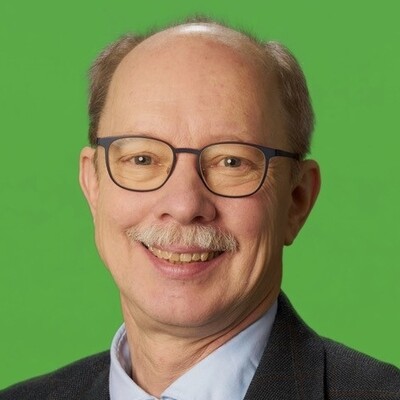
Leiter Bezirksstelle Uelzen
Im internationalen Projekt „Water and Energy Advanced Management for Irrigation“ (WEAM4i) wurden neue Ansätze zu Verringerung der Energiekosten untersucht. Einerseits wurden Möglichkeiten der Teilnahme am Strommarkt zu Nutzung von Niedriglastpreisen geprüft. Andererseits wurden Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz der in der Beregnung eingesetzten Energie erforscht.
„Verbessertes Management von Wasser- und Energie in der Beregnung“ (Water and Energy Advanced Management for Irrigation) waren gleichzeitig Titel und Ziel des aus EU-Mitteln geförderten Projekts im 7. Forschungsrahmenplan unter spanischer Leitung, an dem verschiedene norddeutsche Partner beteiligt waren. Neben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Sachgebiet Beregnung und Bezirksstelle Uelzen) bearbeiteten der Beregnungstechnikplaner und –ausrüster LGRain (Wrestedt, Landkreis Uelzen), der Beregnungsinfrastrukturplaner Schulz + von der Ohe (Uelzen), die Firma Yara (hier: Hennigsdorf bei Berlin) sowie der Energiemarktanalyst Eclareon (Berlin) unterschiedliche Forschungsansätze zur Verringerung des Energiebedarfs. Weitere Partner kamen aus Portugal, Spanien, Frankreich und den Niederlanden.
Zwei verschiedene Ansätze wurden verfolgt. Einerseits sollte der Stromverbrauch gesenkt werden. Andererseits sollten Phasen mit niedrigen Strompreisen genutzt werden.
Erster Ansatz: Teilnahme an der Strombörse?

Da jedoch nur erhebliche Stromnachfragemengen an der Börse berücksichtigt werden könnten, ist eine fortlaufende Bündelung der jeweils zu erwartenden Beregnungsstromnachfrage zwingend erforderlich. Die spanisch und portugiesischen Projektpartner versuchten, diese Prognose durch eine automatisierte Meldung des voraussichtlichen Beregnungsbedarfs (4 Tage, 6 Tage) aller beteiligten Felder auf Basis von lokalen Wettervorhersagen und automatisierter Bodenfeuchtemessungen zu erreichen.
Untersuchung von Aktionsmöglichkeiten am deutschen Strommarkt
Für die deutsche Feldberegnung erscheint dieser Bündelungsansatz nicht umsetzbar. Die für Spanien und Portugal beschriebenen Spielräume für den zeitlichen Einsatz der Beregnungspumpen fehlen hier weitgehend. Eine aktive Anpassung an Niedrigpreisphasen ist praktisch noch weitgehend ausgeschlossen angesichts fehlender Speicher- oder Beregnungskapazitäten. Darüber hinaus können die lokalen Witterungsunterschiede oftmals nicht ausreichend prognostiziert werden. Schließlich ist das Zuordnen eines Stromverbrauchers (Elektropumpe) zu den demnächst zu bewässernden Feldern in der Praxis nicht automatisierbar.
Fazit: die Nachfrage der deutschen Beregner kann weder ausreichend gebündelt noch hinreichend prognostiziert werden, um direkt am Strommarkt teilzunehmen. Letztendlich verringert auch die übliche Abrechnung von Stromkosten auf Gemeinschaftsbasis (Beregnungsverband) die Anpassungsanreize für Einzelne.
In Fällen lokaler Wasserknappheit während der Beregnungssaison kann die Zwischenspeicherung von Winterniederschlägen jedoch in Zukunft Bedeutung gewinnen. Steht während des Winterhalbjahrs Oberflächenwasser vor Ort zur Verfügung, wären Speicherbecken in die Beregnungsnetze zu integrieren oder Flächen für eine künstliche Versickerung in den Grundwasserkörper an dafür geeigneten Standorten einzurichten. Solche Vorhaben bedürften jedoch ganz erheblicher finanzieller und auch administrativer öffentlicher Unterstützung.
Zweiter Ansatz: die Effizienz des Stromverbrauchs verbessern
Diese Strategie wurde überwiegend von den deutschen Partnern auf folgenden Ebenen verfolgt:
Verbesserung der Energieeffizienz vorhandener Pumpen durch Düsendruck abhängige Programmierung von Steuerungsmustern
Als erster Arbeitsschritt wurden die drei Beregnungsnetze hinsichtlich ihrer hydraulischen Güte (Leitungsquerschnitte, Höhenlagen der Felder und Brunnen, Pumpenkapazitäten, -verbräuche und –ausstattungen) aufgenommen und in einem Modell nachempfunden. Im zweiten Schritt wurden alle im Netz üblichen Kombinationen der Aufstellung der beteiligten Regenmaschinen erfasst. Unter der Annahme, dass an allen Düsen ein Mindestdruck von etwa 4,5 bar erreicht werden muss, wurden mittels des Modells dann die sparsamsten Brunnenkombinationen bzw. Pumpeneinstellungen ermittelt und zu einem Steuerungsprogramm weiterentwickelt.
Im echten Betrieb werden Druck und Position der Regner laufend an einen zentralen Rechner gesendet, welcher mit diesen Informationen den Betrieb der Förderpumpen (Pumpenkombination, Pumpenfrequenz) entsprechend steuert bzw. gegebenenfalls automatisch anpasst. Zwei Sommer lang wurde die Steuerung täglich überprüft und die Programmierung schrittweise verfeinert.

Der entwickelte Solarantrieb mit Batterie erscheint für sonnenreiche Regionen sehr vielversprechend und wird nach dem Ende von WEAM4i in diesem Sinne weiter verfeinert werden. Der entwickelte Hydraulikantrieb ist für Situationen geeignet, in denen eine stationäre Beregnungsanlage - aus arbeitswirtschaftlichen und pflanzenbaulichen Gründen - innerhalb eines vorhandenen Hochdrucknetzes integriert werden soll. Musste in solchen Fällen der im Leitungsnetz vorhandene hohe Wasserdruck bisher wirkungslos abgeführt werden, wird dieser Druck nun über Hydraulikmotoren zum Antrieb der Fahrwerke genutzt.
Außerdem wurde ein Programm weiterentwickelt, mit dem auf der Basis von Satellitenfotos schnell und anschaulich Kreis- bzw. Linearberegnungen individuell für konkrete Felder skizziert werden können.

Daneben testete die Landwirtschaftskammer auf Praxisschlägen ein feldspezifisches Wasserbilanzierungssystem zur Bedarfsvorhersage (Niederschlag – Verdunstung), welches durch regelmäßige Satellitenfotografie unterstützt wird. Die Eingabe der feldspezifischen Beregnungsmengen erfolgte durch die teilnehmenden Betriebe via Smartphone-App. Die Beregnungsempfehlungen kamen online, zu Projektende waren sie dann auch direkt per Smartphone abrufbar. Eine weitere Anpassung der getesteten Bedarfsvorhersage an Praxisbedingungen, wie z. B. begrenzte Wasserverfügbarkeit und Berücksichtigung der variablen Beregnungskosten ist erforderlich.
Über diese auf norddeutsche Fragestellungen zugeschnittenen Untersuchungen zur Vermeidung von Energiekosten hinaus profitierten die beteiligten Firmen und die Landwirtschaftskammer bei den Treffen an den verschiedenen europäischen Beregnungsstandorten allgemein vom Kennenlernen anderer Herangehens- und Sichtweisen.
Fazit:
(Dieser Artikel wurde bereits in ähnlicher Form in der Land- und Forstwirtschaftlichen Zeitung für Niedersachsen, Ausgabe 26/2017 veröffentlicht.)