Getreide feucht konservieren?
Bald beginnt die Gerstenernte. Betriebe, die regelmäßig ihr Getreide feucht konservieren, sollten jetzt die Routinearbeiten erledigen, damit die Konservierung optimal gelingen kann. Neben der Reinigung der Lagerstätten gehört die Kontrolle der Konservierungstechnik dazu. Bei Bedarf sollten nach der Säuberung Vorratsschädlinge bekämpft werden, wobei neben den Sicherheitsbestimmungen auch die Wartezeiten einzuhalten sind. Nach der Ernte ist es wichtig, das Getreide möglichst schnell lagerstabil zu machen. Die Getreidequalität bleibt nach der Ernte laut Empfehlung des Max Rubner-Instituts erhalten, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind.
| Kornfeuchte | maximal 12 bis 14,3 % (abhängig von der Getreideart) |
| Getreidetemperatur | max. 20° C |
| Relative Luftfeuchte | 60% |
| Wasseraktivität (aw-Wert, beeinflusst das Keimwachstum, Werte von 0-1) | 0,60 bis 0,65 |
| Abwesenheit von tierischen Schaderregern |
Für die Feuchtkonservierung sprechen hohe Trocknungskosten, ungünstige Witterungsbedingungen, fehlende Getreidesilos und früheres Räumen der Getreideflächen. Bei der chemischen Haltbarmachung ist zu beachten, dass derart konservierte Ware nicht in den Handel gelangen darf. Neben der Konservierung mit Säuren zählen noch die Behandlung mit Natronlauge (Durchmischung im Futtermischwagen, „Sodagrain“) und mit Futterharnstoff (Freisetzung von Ammoniak) zu den chemischen Konservierungsverfahren, sind aber in der Praxis weniger verbreitet.
Die Feuchtgetreidekonservierung mit organischen Säuren, überwiegend mit Propionsäure oder Kombipräparaten, zählt zu den verbreitetsten Verfahren. Die Säurekonservierung, deren Wirkungsprinzip das Unterdrücken schädlicher Mikroorganismen ist, besticht durch ihre Schlagkraft und die guten hygienischen Eigenschaften des Endproduktes. Vorteilhaft ist auch, dass keine Atmungsverluste auftreten und keine Belüftung zur Lagerpflege erforderlich ist. Es sollten nur einwandfreie Partien konserviert werden, ansonsten muss vorab eine gründliche Getreidereinigung erfolgen. Die ist jedoch auf vielen Betrieben nicht vorhanden.
Säure gut gegen Bakterien, Pilze und Kornkäfer
Für die Säurekonservierung werden ein Dosiergerät und eine Rohrschnecke benötigt, in der das Aufsprühen und Anmischen der Säure erfolgt. Die Wirkung der Propionsäure besteht einerseits darin, dass sie den pH - Wert auf der Kornoberfläche senkt, so dass die am Getreide haftenden Mikroorganismen abgetötet bzw. deren Vermehrung verhindert wird. Zum anderen kann das undissoziierte Säuremolekül die Zellwand der Mikroorganismen durchdringen, den pH-Wert im Zellkern und somit den osmotischen Druck reduzieren. Das führt dann zum Zelltod. Durch den Säureeinsatz geht die Keimfähigkeit verloren. Propionsäure wirkt sowohl bakteriostatisch als auch fungizid. Durch einen Zusatz von 2 % zu Getreide, das von Kornkäfern befallen ist, stirbt der größte Teil der Kornkäfer ab. Bereits eine Dosis von 0,7 bis 1 % beugt dem Insektenfraß vor. Eine exakte Feuchtemessung ist wichtig, da die Säuremenge von der Kornfeuchte und der Lagerdauer abhängt. Ebenso muss die Förderleistung der Getreideschnecke genau ermittelt werden. Bei der Dosierung ist zwischen Korn (Tabelle 2) und Schrot (Tabelle 5) zu unterscheiden.
| Feuchte (%) | Lagerdauer (Monate) | |||
| bis 1 | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 | |
| 14-16 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |
| 16-18 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,65 |
| 18-20 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| 20-22 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
| 22-24 | 0,55 | 0,7 | 0,85 | 0,95 |
| 24-26 | 0,6 | 0,8 | 0,95 | 1,05 |
| 26-28 | 0,7 | 0,9 | 1,05 | 1,15 |
| 28-30 | 0,8 | 1 | 1,15 | 1,3 |
| 30-32 | 0,9 | 1,1 | 1,25 | 1,45 |
| 32-34 | 1 | 1,2 | 1,35 | 1,6 |
| 34-36 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,75 |
| 36-38 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,9 |
| 38-40 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,05 |
| 40-42 | 1,55 | Jan 75 | 1,95 | 2,2 |
| 42-44 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,35 |
| 44-46 | 1,85 | 2,05 | 2,25 | 2,55 |
| 46-48 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,75 |
| 48-50 | 2,15 | 2,35 | 2,6 | 2,95 |
Wird das Getreide direkt nach dem Verlassen der Schnecke pneumatisch weitergefördert, muss die Säuremenge wegen der Abdrift durch den Luftstrom um 10 % erhöht werden, es sei denn, eine Zwischenlagerung von einer Stunde ist möglich. Bei hohen Einlagerungstemperaturen ist ein Zuschlag von 10 % sinnvoll, weil bei Hitze Säure verdampfen kann. Grundsätzlich sollten nur Säureprodukte eingesetzt werden, für die eine Dosiertabelle vorliegt.
| Gebläseförderung | 10% |
| Einlagerung bei > 35 °C | 10% |
| Einlagerung von geschrotetem Getreide | 20-25 % (s. Tabelle 5) |
Die flüssige Säure wird über mindestens zwei im unteren Bereich der Rohrschnecke montierte Düsen auf das Getreide aufgesprüht, wobei die Anzahl der Düsen vom Schneckendurchmesser abhängt.
|
Schneckendurchmesser |
Düsen |
|
<180 mm 180 – 200 mm >200 mm |
2 - 3 Düsen (höhere Anzahl für abgepufferte Produkte) 3 – 4 Düsen mind. 4 Düsen |
Die Düsen sollten im Abstand von 1,5 Schneckengängen angebracht sein. Im weiteren Verlauf der schräg stehenden Schnecke (mind. 30°) wird die Säure an das Korn gemischt. Die Schnecke sollte mindestens 3 m lang sein, damit das Getreide gleichmäßig durchmischt werden kann. Der Konservierungsvorgang ist beendet, wenn das behandelte Korn aus der Schnecke herauskommt, wobei die Säure noch etwa eine Stunde benötigt, um in das Korn einzuziehen.
Säure wirkt korrosiv und ätzend
Propionsäure wirkt korrosiv, deshalb müssen nach dem Säureeinsatz noch einige Dezitonnen unbehandeltes Getreide mit der Schnecke gefördert werden. Während Holzsilos eine gute Lagerungsmöglichkeit darstellen, sind Silos aus Beton, verzinktem Blech oder Eisen kaum geeignet. Besser sind ein säurefester Anstrich oder das Auskleiden der Silos mit einer säurefesten Kunststofffolie. Bei Feuchtegehalten des Getreides unterhalb von 18 % und einem Säurezusatz von 0,65 % kann eine Zwischenlagerung des Getreides von zwei bis drei Stunden die korrosive Wirkung so stark herabsetzen, dass eine Einlagerung möglich ist. Bei Verwendung von Säuren gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen. Schutzhandschuhe, Atemschutzmaske und Schutzbrille sind zu tragen, um Hautkontakt und das Einatmen der Dämpfe zu vermeiden.
Abgepufferte Produkte (NC-Produkte, pH-Werte zwischen ca. 4,0 und 7,0) sind weniger korrosiv, aber zähflüssiger als die reine Propionsäure. Bei ihrem Einsatz ist eine höhere Düsenzahl erforderlich. Sie schonen Fördergeräte und Silos und sind ungefährlicher für den Anwender, weil sie nicht ätzend, sondern nur reizend wirken. Nachteilig ist, dass sie teurer sind und die Viskosität stark temperaturabhängig ist. Die Dosierpumpe muss deshalb bei kühlen Morgenstunden anders eingestellt werden als bei hohen Temperaturen am Nachmittag. Hier ist die reine Propionsäure im Vorteil, da das Dosiergerät mit Wasser ausgelitert werden kann. Für alle Mittel gilt, dass sie unbedingt nach Herstellerangaben dosiert werden sollten, ansonsten kann es böse Überraschungen bezüglich der Futterqualität geben
Fehler bei der Konservierung
Ist das Konservierungsergebnis unbefriedigend, liegt das meist an einer fehlerhaften Dosierung. Deshalb ist eine Unterdosierung grundsätzlich zu vermeiden. Denn im Laufe der Zeit verdampft ein Teil der Säure, so dass sich das Getreide nach einer entsprechenden Lagerdauer erwärmt, weil die für eine sichere Konservierung erforderliche Säurekonzentration unterschritten wird. Unter diesen Lagerbedingungen können Pilze gut wachsen. Ein weiterer Grund einer nicht erfolgreichen Konservierung kann neben einer schlechten Verteilung der Säure auch darin liegen, dass feuchte und trockene Partien zusammen in einem Haufen gelagert werden, die Feuchtigkeit aus der feuchten in die trockene Partie wandert und diese dann verdirbt. Deshalb muss die Behandlung in solchen Fällen auch bei trockenem Getreide in gleicher Dosierhöhe erfolgen wie bei der feuchtesten Partie im Stapel. Unbehandeltes und Säure konserviertes Getreide sollte also nie zusammen gelagert werden!
Schüttkegel müssen eingeebnet werden, um den Kamineffekt und die daraus folgenden Luftbewegungen zu vermeiden. Eine leichte Überdosierung von 0,1 bis 0,2 % ist gerade in kritischen Erntejahren empfehlenswert. Damit kann zwar eine weitere Pilzvermehrung unterbunden werden, ein bereits geschädigtes Futtermittel lässt sich damit aber nicht wieder in einen einwandfreien Frischezustand versetzen. Eine Abdeckung mit Folie ist bei Lagerung unter Dach nicht sinnvoll, da sich darunter Schwitzwasser bilden und die oberste Schicht verderben kann.
Getreideschrot konservieren
Neben ganzen Körnern kann auch geschrotete Ware mit Propionsäure konserviert werden.
Dabei wird das Getreide sofort nach der Ernte in CCM-Mühlen geschrotet, mit Säure konserviert, unter Dach (ohne Folie) oder in Fahrsilos eingelagert. Ein Festfahren ist nicht
erforderlich. Bei Fahrsilos sollte eine Folie als Witterungsschutz erst nach dem Abkühlen des Getreides aufgelegt werden. Die im Vergleich zu ganzen Körnern größere Oberfläche des Schrotes erfordert eine höhere Dosierung. Eine Säurebehandlung von gequetschtem Getreide ist ebenfalls möglich.
|
Feuchte (%) |
Lagerdauer (Monate) |
||
|
|
1 |
1 - 3 |
3 - 12 |
|
Bis 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 32 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 |
0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,15 1,30 1,45 1,60 1,75 1,90 2,10 |
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,25 1,40 1,55, 1,70 1,95 2,10 2,25 |
0,70 0,85 1,00 1,15 1,25 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,30 |
Bei der Konservierung von Schrot ist zu beachten, dass der Anschnitt bei jedem Wetter erfolgen muss, das Schrot früher warm wird, Kondensation unter der Folie einsetzt und eine warme Einlagerung unter Folie zu Problemen führen kann.
Wenn Getreide wie Schwarzbrot aussieht
Probleme können nach dem Einlagern von feucht vermahlenem, säurekonserviertem Auswuchsgetreide auftreten, insbesondere bei nassen Partien. Nach dem Öffnen des Silos riecht das Getreide nicht nur angenehm röstartig wie Schwarzbrot, sondern es sieht auch so dunkel aus. Während der äußere Rand nicht betroffen ist, ist der Kern schwarz, heiß und sehr hart, denn durch die hohen Temperaturen verklumpt das Mehl. Beim Mahlvorgang erhitzt sich das Getreide durch die Reibung sehr stark, und die Stärke des gekeimten Feuchtgetreides verkleistert. Ursachen für die dunkle Verfärbung sind in erster Linie der Zucker, der beim Keimvorgang aus der Stärke gebildet wird, und Aminosäuren. Je intensiver die Hitzeeinwirkung, desto stärker sinkt der Lysin- und Energiegehalt.
Feuchtgetreide mit einem Gehalt bis max. 20 % Wasser kann problemlos in Hammermühlen geschrotet werden. Bei höheren Gehalten sind Hammermühlen mit Gebläse und 6 mm-Siebe einzusetzen.
Hinsichtlich der Kosten muss beachtet werden, dass mit Propionsäure behandeltes Getreide praktisch keine Lagerverluste hat. Hinzu kommt noch eine abtötende Wirkung auf Mikroorganismen, so dass dadurch evtl. eine Leistungsverbesserung eintreten kann.
Säureeinsatz dokumentieren
Landwirte müssen den Einsatz von Zusatzstoffen, z.B. Propionsäure, dokumentieren. Dazu müssen sie ein HACCP-Konzept (System zur Risikominimierung) einrichten und die Anforderungen aus dem Anhang 2 der Futtermittelhygiene-Verordnung einhalten. Im Fall der Säurekonservierung kann ein vereinfachtes HACCP („Merkblatt für den Einsatz von Futtermittel-Zusatzstoffen im landwirtschaftlichen Betrieb - Teil 1: Säuren als Konservierungs-mittel“) durchgeführt werden. Das Merkblatt ist auf der LWK-Homepage unter dem Webcode 01023776 abrufbar.
Transportbeschränkungen für Propionsäure
Landwirte ohne Gefahrgutführerschein dürfen max. 333 kg Propionsäure transportieren. Ein Container mit 1000 kg darf also ohne Gefahrgutführerschein nicht mehr vom Landhandel oder der Genossenschaft abgeholt werden. Abgepufferte Produkte gelten nicht als Gefahrgut.
Silierung von Getreide
Neben der Säurekonservierung kommt auch die Silierung in Betracht, insbesondere bei zunehmenden Feuchtegehalten und hohen Preisen für Propionsäure. In der Praxis wird zwischen diesen beiden Verfahren häufig nicht sauber differenziert. Die Wirkungsprinzipien sind aber unterschiedlich, denn bei der Silierung werden bei luftdichter Lagerung Gärsäuren (pH-Wert senkend) und CO2 (pilzabtötend) gebildet. Hier sind Feuchtegehalte von mindestens 25 % notwendig. Das Feuchtgetreide kann entweder im Fahrsilo mit Folie luftdicht abgedeckt oder geschrotet/gequetscht in Folienschläuche gepresst werden. Wegen des meist geringen Besatzes an Milchsäurebakterien und höheren Besatzes an Hefen im frischen Erntegut sind entsprechende Zusätze zur Stabilisierung ratsam. Bei geringem Vorschub sind Zusätze, wie z.B. heterofermentative Milchsäurebakterien, zur Verbesserung der aeroben Stabilität zu empfehlen. Sinnvoll ist eine Silierdauer von mindestens zehn Wochen.
Kontakte

Andrea Meyer
Rinderfütterung, Schweinefütterung, Futterberatungsdienst e.V.
Hitzestress bei Schweinen - Fütterung anpassen
Schweine reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Kommt dann noch eine hohe Luftfeuchtigkeit dazu, kann es für die Tiere unerträglich werden. Folgen dieser Wärmebelastung können Kreislaufprobleme und Leistungseinbußen …
Mehr lesen...Lupinen für Rinder und Schweine
Über Körnerleguminosen als heimische Eiweißfuttermittel wird viel diskutiert. Projekte wie das Legunet oder die Bundes-Eiweißpflanzenstrategie wollen ihren Einsatz fördern. Trotz der bekannten Vorteile wie die …
Mehr lesen...Getreidepreise Juni 2024
Als Richtwerte schlagen wir die vom Fachbereich 3.1 der Landwirtschaftskammer vorläufig geschätzten Getreidepreise (netto) in €/100 kg für die Futterkostenberechnung vor.
Mehr lesen...Ferkelfutter von Oktober bis Dezember 2023 überprüft
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen teilt mit, dass der Verein Futtermitteltest im 4. Quartal 2023 sechs Ferkelaufzuchtfutter I, zwei Ferkelaufzuchtfutter II und ein Ergänzungsfutter für Ferkel überprüft hat. Die FAZ I waren …
Mehr lesen...Sauenfutter von Oktober bis Dezember 2023 überprüft
Die LWK Niedersachsen teilt mit, dass der Verein Futtermitteltest neun Sauenalleinfutter, und zwar vier Futter für säugende und fünf für tragende Sauen, im 4. Quartal 2023 überprüft hat. Die Laktationsfutter waren mit 13…
Mehr lesen...Weitere Arbeitsgebiete
Drittmittelprojekte
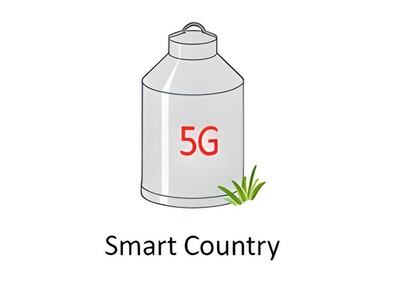
5G Smart Country
Ausgangslage Weltbevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung und schwieriger werdende klimatische Bedingungen machen es erforderlich, noch mehr Nahrung zu produzieren. Laut Prognosen muss die landwirtschaftliche Erzeugung mind. um 50% erhö…
Mehr lesen...
Abibewässerung
Ausgangslage Die durch den Klimawandel zunehmend negative klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode führt zu einem erhöhten Bedarf an Wasser für die Feldberegnung. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Nutzungskonkurrenz um …
Mehr lesen...
ADAM
Ausgangslage ADAM ist ein 42-monatiges transdisziplinäres Forschungs- und Umsetzungsprojekt zur Steigerung der Biodiversität im Intensivgrünland. Es sind Partner aus der Wissenschaft (Bewilligungsempfänger Universität Gö…
Mehr lesen...
AGrON
Ausgangslage In Deutschland gibt es regionale Unterschiede beim landwirtschaftlichen Nährstoffanfall. So gibt es beispielsweise in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Landkreise mit starkem Nährstoffüberschuss, aber auch …
Mehr lesen...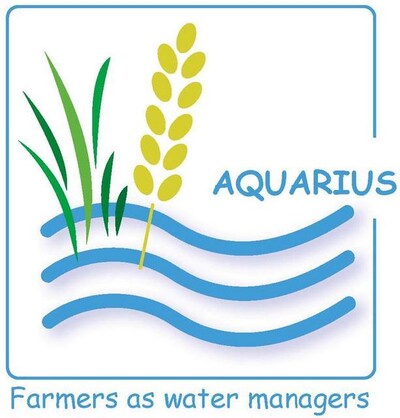
AQUARIUS
Ausgangslage Die Niederschläge in der östlichen Lüneburger Heide sind deutlich niedriger als im übrigen Niedersachsen. Der eigentliche Wasserbedarf der landwirtschaftlichen Kulturen liegt dann oftmals sogar noch über …
Mehr lesen...
Biotopverbund Grasland
Ausgangslage Hintergrund dieses Projektes ist der starke Rückgang artenreichen Grünlands und seine zunehmende Verinselung in landwirtschaftlich intensiv genutzten Räumen einerseits und der starke Flä…
Mehr lesen...