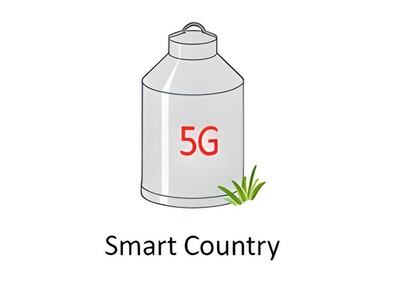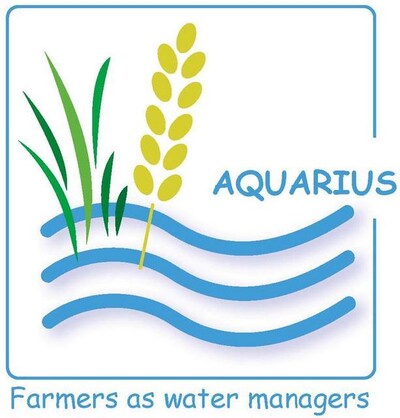Natürliches Grünland zeichnet sich durch eine hohe ökologische Wertigkeit aus. Aus diesem Grund ist es für Kompensationszwecke infolge öffentlicher, gewerblicher oder privater Bauvorhaben, aber auch für allgemeine Naturschutz- oder Agrarumweltmaßnahmen sehr begehrt. Um den Forderungen von Natur-, Umwelt-, Boden- oder Wasserschutz Rechnung zu tragen, werden die Flächen der „intensiven“ Bewirtschaftung entzogen, entsprechend den jeweiligen Schutzzielen mit Bewirtschaftungsauflagen versehen und eher „extensiv“ bewirtschaftet und genutzt. Einschränkungen bei den Pflege- und Schnittmaßnahmen, insbesondere hinsichtlich der späteren Durchführbarkeit oder der Düngungsart und –intensität führen in der Regel zu geringeren Masseerträgen und zu einem geringeren Futterwert betroffener Flächen.
Da die Nachfrage nach solchen Flächen stetig steigt, fürchten intensive Milchviehalter, auch vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Biomasse für die Energiegewinnung, dass Ihnen Futter- und Dungnachweisflächen verloren gehen. Sofern Sie diese Flächen weiter bewirtschaften können, besteht die Befürchtung, dass weder die Futtermengen noch die Futterqualitäten ausreichen, um hohe Leistungen bei Jungtieren und Kühen zu realisieren. Vor diesem Hintergrund hat die Feldversuchsstation für Grünlandwirtschaft und Rinderhaltung Ovelgönne in der Vegetationsperiode 2012 damit begonnen, entsprechende Daten in Praxisbetrieben, die Grünlandflächen mit Auflagen bewirtschaften, zu erheben. Berücksichtigt werden nur Schnittflächen bzw. Wiesen.
Material und Methoden
Insgesamt wurden extensive Grünlandflächen von vier Betrieben mit den unterschiedlichen Standorten Brackmarsch, Hochmoor, Niedermoor und Geest in die Erhebung einbezogen.
Die Bewirtschaftungsauflagen und Nutzungsbeschränkungen der einzelnen Flächen sind sehr unterschiedlich.
Bei der Niedermoorfläche handelt es sich um eine Naturschutzfläche. Sie darf weder gedüngt noch im Frühjahr geschleppt oder gewalzt werden. Die erste Schnittnutzung darf ab dem 15. Juli erfolgen. Eine Besonderheit ist, dass das Oberflächenwasser bis zum 15. Juni aufgestaut wird. Eine Beweidung ist aufgrund der Nässe in den meisten Jahren nicht möglich. Die Fläche wird, soweit es die Befahrbarkeit zulässt, zweimal jährlich zur Heuwerbung geschnitten. Bei der botanischen Aufnahme unmittelbar vor der ersten Nutzung in 2012 setzte sich der Vegetationsbestand zu 70 Prozent aus Gräsern und zu 30 Prozent aus Kräutern zusammen (Tab.1). Hauptbestandsbildner bei den Gräsern waren in absteigender Reihenfolge Wolliges Honiggras, Binsen und Sumpfschwingel. Bei den Kräutern überwogen der Kriechende Hahnenfuss sowie der Kleinblättrige Ampfer.
|
Bestands-bildner |
Standort |
|||||
|
Niedermoor |
Geest |
Brackmarsch |
Hochmoor |
|||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Gräser (%) |
70 |
75 |
90 |
83 |
92 |
96 |
|
Kräuter (%) |
30 |
25 |
10 |
17 |
8 |
4 |
Auch die Geestfläche ist eine Naturschutzfläche. Eine organische Düngung mit 10 t Rindermist und eine verhaltene mineralische Ergänzung mit Phosphat- und Kaliumdüngern sind erlaubt, werden aber nicht durchgeführt. Pflegemaßnahmen wie Walzen oder Striegeln dürfen nur bis zum 31. März durchführt werden. Die erste Schnittnutzung darf ab dem 1. Juli erfolgen. In 2012 wurde die Fläche zweimal gemäht und dabei einmal Heu und einmal Heulage geworben. Der Pflanzenbestand zur ersten Nutzung setzte sich zu 75 Prozent aus Gräsern und zu 25 Prozent aus Kräutern zusammen. Bei den Gräsern dominierten die Gemeine Rispe, die Flatterbinse sowie das Wollige Honiggras. Bei den Kräutern der Kriechende Hahnenfuß.
Bei der Brackmarschfläche handelt es sich um eine Kompensationsfläche. Düngungsmaßnahmen dürfen nicht durchgeführt werden. Die erste Nutzung darf am 1. Juli erfolgen. Auch diese Fläche wurde in 2012 zweimal gemäht, wobei der erste Schnitt als Heu und der zweite Schnitt als Heulage geerntet wurden. Der Pflanzenbestand zum ersten Schnitt setzte sich zu 90 Prozent aus Gräsern und zu 10 Prozent aus Kräutern zusammen. Bei den Gräsern überwog der Wiesenfuchsschwanz mit 55 Prozent am Gesamtpflanzenbestand.
Die Hochmoorfläche 1 ist ebenfalls eine Kompensationsfläche. Die Hochmoorflächen 2 und 3 sind Naturschutzflächen. Im Gegensatz zu den anderen Naturschutzflächen dürfen diese beiden einmal jährlich mit 15 m³ Gülle je Hektar und Jahr gedüngt werden. Die Kompensationsfläche ebenso. Diese darf zusätzlich noch mit 60 kg mineralischem Stickstoff je Hektar und Jahr versorgt werden. Die erste Nutzung darf bei der Kompensationsfläche ab dem 1. Juli bei den Naturschutzflächen ab dem 15. Juli erfolgen. Während die beiden Naturschutzflächen in 2012 lediglich einmal zur Heuwerbung genutzt wurden, wurde die Kompensationsfläche dreimal gemäht und der Aufwuchs als Silage geerntet.
Als Bestandsbildner dominierten auf allen drei Flächen mit jeweils 83 % sowie 92 % und 93 % die Gräser.
Sämtliche Erntemengen der jeweiligen Standorte und Nutzungen wurden gewogen und anschließend repräsentativ beprobt. Die Analytik der Futter wurde von der LUFA Nordwest durchgeführt. Die Ermittlung der Nährstoffgehalte erfolgte nass-chemisch. Für die Feststellung der Keimbelastung wurde das Heu nach vier bis fünfmonatiger Lagerdauer beprobt.
Den vollständigen Bericht entnehmen Sie bitte der beigefügten PDF-Datei.