Weniger Protein für Milchkühe?
Die N-Ausscheidungen reduzieren – dieses Thema wird seit langem in der Schweine- und Geflügelhaltung bearbeitet, während es in der Milchkuhfütterung bislang eine eher untergeordnete Rolle spielte. Die Höhe der Stickstoffausscheidungen und der Ammoniakemissionen von Kühen geraten aber gegenwärtig immer mehr in den Fokus (Novellierung der Düngeverordnung, Wegfall der 230 kg N-Regelung, EU-Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen etc.).
Viele Betriebe haben noch Reserven in der Proteinversorgung von Milchkühen. Durch eine angepasste Eiweißzufuhr können mögliche Stoffwechselbelastungen durch unnötige Rohproteinüberschüsse verhindert sowie Proteinkonzentrate und Futterkosten gespart werden. Gleichzeitig bietet ein verringerter N-Input im Bedarfsfall natürlich auch die Möglichkeit, die N-Ausscheidungen der Kühe zu verringern und betriebliche N-Bilanzen zu optimieren. Jedoch sollen auch dann daraus keine Leistungsminderung und/oder insbesondere keine wirtschaftlichen Verluste resultieren.
Wie sich die Umstellung von Milchkühen mit hohem Leistungspotenzial auf Rationen mit abgesenkten Rohproteingehalten und mit stark negativ ausgeprägter RNB auswirkt, haben die Landwirtschaftskammer Niedersachen und die LLFG Sachsen-Anhalt in einem Fütterungsversuch im ZTT Iden geprüft.
2 % weniger Rohprotein im Versuchsfutter
In den Versuch, der die ersten 100 Laktationstage umfasste, wurden 75 DH-Kühe einbezogen, die auch schon vor der Kalbung und in der ersten Laktationswoche Rationen mit stark negativer RNB erhielten. Danach erfolgte die Aufteilung der Tiere in zwei vergleichbare Gruppen. Die Kontrollgruppe bekam eine TMR, deren Proteingehalte knapp am kalkulierten Bedarf für die erwartet hohe Milchleistung ausgerichtet war. Muster für diese Versorgung war die auf Effizienz ausgerichtete Routinefütterung der Idener Herde. Für die Kühe der Versuchsgruppe wurde weiter die Ration mit geringerem Rohproteingehalt (144 statt 163 g/kg TM) und negativer RNB eingesetzt. Auch die nXP-Konzentrationen waren gegenüber der Kontrollvariante noch reduziert. Die Zusammensetzung der Rationen und deren Gehaltswerte zeigt die Tabelle 1. Den Kühen der Versuchsgruppe wurden also durchschnittlich etwa 1,3 kg Extraktionsschrote weniger angeboten als den Kontrolltieren und durch Energiekonzentrat, hauptsächlich melassierte Trockenschnitzel und etwas Getreide, ersetzt.
|
Futtermittel Futterwertparameter |
Variante/TMR |
|
|
Versuchsgruppe |
Kontrollgruppe |
|
|
|
Anteil an der TM der TMR (%) |
|
|
Maissilage / Grassilage / Stroh |
28 / 24 / 3 |
|
|
Raps- / Sojaextraktionsschrot |
14 / - |
16 / 3 |
|
Mais / Getreide / Trockenschnitzel |
8 / 10 / 10 |
8 / 9 / 6 |
|
Rationsergänzung* |
3 |
3 |
|
|
Gehalte je kg TM der TMR |
|
|
NEL (MJ) |
7,1 |
7,1 |
|
Rohprotein / nXP / RNB (g) |
144 / 153 / -1,5 |
163 / 160 / 0,4 |
|
Rohfaser / NDF (g) |
162 / 324 |
160 / 320 |
|
Stärke + Zucker (g) |
270 |
261 |
* pansenstabiles Pflanzenfett, Propylenglycol + Glycerin, Mineralfutter
Die Kühe der Versuchsgruppe reagierten auf die proteinärmere Fütterung mit geringeren Futteraufnahmen (Tabelle 2) im Vergleich zu den Kühen der Kontrollgruppe. Der Unterschied war zwar nicht statistisch gesichert, aber die Verläufe des Trockenmasseverzehrs in den beiden Gruppen im ersten Laktationsdrittel deuten auf einen Einfluss der unterschiedlichen Versorgung hin (Grafik). Ganz erhebliche Differenzen ergaben sich natürlich bei den Aufnahmen an Rohprotein und bei der RNB zwischen den Gruppen sowie, wenn auch etwas geringer in der Ausprägung, auch beim nXP. Diese Unterschiede sind dann auch als Ursache für die geringeren Milch- und Milcheiweißleistungen in der Versuchsgruppe anzunehmen.
Trotz der um ca. 20 Cent geringeren Futterkosten je Tier und Tag in der Versuchsgruppe während des Untersuchungszeitraums lag der Verlust gegenüber den Kontrollkühen als Folge der Milchgeldeinbußen bei täglich etwa einem Euro je Kuh. (Die genaue Kalkulation kann bei den Autoren abgefordert werden.)
|
Parameter |
Versuchsgruppe |
Kontrollgruppe |
|
TM-Aufnahme (kg/Tag) |
22,2 |
23,0 |
|
Energieaufnahme (MJ/Tag) |
158 |
164 |
|
Rohproteinaufnahme (g/Tag) |
3183a |
3731b |
|
nXP-Aufnahme (g/Tag) |
3395a |
3678b |
|
RNB (g/Tag) |
-34a |
9b |
|
Milchmenge (kg/Tag) |
41,1a |
44,1b |
|
Milchfettgehalt (%) |
3,89 |
3,90 |
|
Milcheiweißgehalt (%) |
3,25 |
3,27 |
|
Milchfettmenge (g/Tag) |
1626 |
1760 |
|
Milcheiweißmenge (g/Tag) |
1344a |
1455b |
|
Milchharnstoffgehalt (mg/l) |
155a |
209b |
abkennzeichnen statistisch gesicherte Differenzen zwischen den Gruppen
In der Tiergesundheit und Stoffwechselstabilität ergaben sich zwischen den Gruppen keinerlei nennenswerte Unterschiede. Die gemessenen Parameter lagen jeweils in einem physiologisch günstigen oder tolerierbaren Bereich. Auch die Fruchtbarkeitsergebnisse waren in beiden Gruppen ähnlich.
Obwohl die Kühe der Kontrollgruppe mehr Rohprotein erhielten, kam es nicht zu einer unphysiologischen Überversorgung. Es waren deshalb auch kein negativen Effekte auf die Tiergesundheit zu erwarten. Dies zeigt auch der mittlere Milchharnstoffgehalt an. Als Grenzwert, der auf keinen Fall überschritten werden sollte, gelten immer noch 300 mg/l Milch. In der Kontrollgruppe ergaben die Messungen nur etwas mehr als 200 mg/l. Das entspricht dem, was für die Fütterung der Idener Kühe auch sonst normal ist und als Zielwert gilt (180 – 240 mg/l).
Den vollständigen Bericht entnehmen Sie bitte der angehängten pdf-Datei.
Downloads
Kontakte

Andrea Meyer
Rinderfütterung, Schweinefütterung, Futterberatungsdienst e.V.
Qualität von Rapsextraktionsschrot
Zur Ernte 2025 beträgt die Rapsanbaufläche in Deutschland etwa mehr als 1,0 Mio. ha, davon liegen weniger als 10 % in Niedersachsen.
Mehr lesen...Getreidepreise März 2025
Als Richtwerte schlagen wir die vom Fachbereich 3.1 der Landwirtschaftskammer vorläufig geschätzten Getreidepreise (netto) in €/100 kg für die Futterkostenberechnung vor.
Mehr lesen...
Bundesweite Kennzahlen zur Therapiehäufigkeit nach Tierarzneimittelgesetz (TAMG) für das Jahr 2024 veröffentlicht
QUELLE: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat heute (14. Februar 2025) auf der hauseigenen Homepage die bundesweiten Kennzahlen zur Therapieh&…
Mehr lesen...Maul- und Klauenseuche (MKS) in Deutschland aufgetreten
Am 10.01.2025 wurde ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) bei Wasserbüffeln im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg amtlich festgestellt. Es handelt sich um den Serotyp 0. Dies war das erste Auftreten des Erregers in …
Mehr lesen...Milchleistungsfutter von Juli bis September 2024 überprüft
Die LWK Niedersachsen teilt mit, dass der VFT 16 Milchleistungsfutter im 3. Quartal 2024 überprüft hat. Darunter waren acht Futter für ausgeglichene Grobfutterrationen. Ein Futter diente zum Ausgleich von Rationen mit geringem Eiwei&…
Mehr lesen...Rindermastfutter im Juli und August 2024 überprüft
Die LWK Niedersachsen teilt mit, dass der Verein Futtermitteltest fünf Rindermastfutter II im Juli und August 2024 überprüft hat.
Mehr lesen...Weitere Arbeitsgebiete
Veranstaltungen

Ganzjährige Weidehaltung von Rinder und Pferden - Praxistag in Sachsen-Anhalt
04.04.2025
Die ganzjährige Weidehaltung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als erfolgreiche Methode zur Pflege extensiver Weiden und Naturschutzflächen etabliert. Diese Form der Bewirtschaftung stellt die Betreiber*innen jedoch beim Management …
Mehr lesen...
Grundlehrgang Klauenpflege
07.04.2025 - 11.04.2025
Das Ziel des einwöchigen Grundkurses ist der Einstieg in die professionelle Klauenpflege. Sie lernen im theoretischen Teil die Grundlagen der Klauenanatomie, die wichtigsten Klauenerkrankungen sowie das Erkennen von Lahmheiten. In die …
Mehr lesen...
Weiterbildung Milchsammelwagenfahrer
08.04.2025
Dieses Webseminar richtet sich an alle Milchsammelwagenfahrer, die bereits an einer Grundschulung erfolgreich teilgenommen haben. Damit wird alle zwei Jahre die Sachkunde der Probenehmer gemäß RohmilchGütV aufgefrischt. Inhaltlich …
Mehr lesen...
Einführung in die Klauenpflege bei Rollklauen
11.04.2025
Zielgruppe: Herdenmanager*innen, Betriebsleiter*innen, Tierärzt*innen, Klauenpfleger*innen Referentinnen: Maike Saß und Dr. Charlotte Kröger, Netzwerk Klaue e.V. Ziel dieses Kurses: Im Rahmen dieses Praxisseminars, rund um…
Mehr lesen...
Klauenpflege bei Rollklauen
12.04.2025
Zielgruppe: Herdenmanager*innen und Betriebsleiter*innen mit Klauenpflegegrundkurs (Nachweis erforderlich) Klauenpfleger*innen (Nachweis erforderlich) &…
Mehr lesen...
Klauenpflege bei Rollklauen
13.04.2025
Zielgruppe: Herdenmanager*innen und Betriebsleiter*innen mit Klauenpflegegrundkurs (Nachweis erforderlich) Klauenpfleger*innen (Nachweis erforderlich) &…
Mehr lesen...Beratungsangebote & Leistungen

Seminarkreis Milch-Landfrauen Emsland
Als engagierte Landfrau auf einem Milchviehbetrieb suchen Sie den fachlichen und persönlichen Austausch mit ihren Berufskolleginnen.
Mehr lesen...
Milchvieh-Spezialberatung
Sie sind ein engagierter Milchviehhalter und wünschen eine fachliche und fundierte Unterstützung in der Beurteilung ihrer Produktionstechnik und/oder bei der Stallbauplanung.
Mehr lesen...
Arbeitsgruppe Rationsplaner
Für Sie ist die gezielte Fütterung der Grundstein des Erfolgs in der Milchviehhaltung, Jungviehaufzucht und Rindermast. Mit Hilfe eines Fütterungsprogramms (Ratíonsplaner) möchten Sie in der Lage sein, notwendige …
Mehr lesen...
Beratung in der Rindermast
Sie beabsichtigen sich zu verschiedenen Themen in der Rindermast informieren. Sie möchten die Haltung in Bezug auf die Tiergerechtheit verbessern und planen möglicherweise eine Stallerweiterung oder einen Neubau. Sie wollen …
Mehr lesen...
Arbeitskreis Bullenmast
Sie möchten Ihre Leistungsergebnisse in der Bullenmast verbessern oder suchen eine Möglichkeit zum (über-)regionalen Informationsaustausch?
Mehr lesen...
Aufzucht von Kälbern und Jungrindern
Sie sind Rinderhalter und mit den Ergebnissen der Aufzucht ihrer Kälber und Jungrinder nicht zufrieden? Sie wollen sich über neue Fütterungs- und Haltungskonzepte informieren? Die Kälber- und Jungtierverluste in Ihrem Betrieb …
Mehr lesen...Drittmittelprojekte
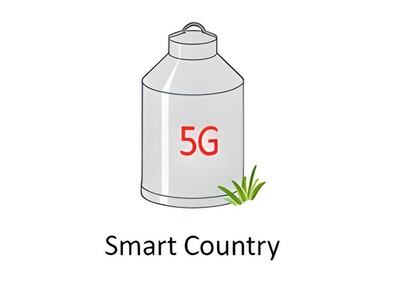
5G Smart Country
Ausgangslage Weltbevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung und schwieriger werdende klimatische Bedingungen machen es erforderlich, noch mehr Nahrung zu produzieren. Laut Prognosen muss die landwirtschaftliche Erzeugung mind. um 50% erhö…
Mehr lesen...
Abibewässerung
Ausgangslage Die durch den Klimawandel zunehmend negative klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode führt zu einem erhöhten Bedarf an Wasser für die Feldberegnung. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Nutzungskonkurrenz um …
Mehr lesen...
ADAM
Ausgangslage ADAM ist ein 42-monatiges transdisziplinäres Forschungs- und Umsetzungsprojekt zur Steigerung der Biodiversität im Intensivgrünland. Es sind Partner aus der Wissenschaft (Bewilligungsempfänger Universität Gö…
Mehr lesen...
AGrON
Ausgangslage In Deutschland gibt es regionale Unterschiede beim landwirtschaftlichen Nährstoffanfall. So gibt es beispielsweise in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Landkreise mit starkem Nährstoffüberschuss, aber auch …
Mehr lesen...
AmmonMind
Ausgangslage Ammoniak (NH3) ist ein Luftschadstoff, der vor allem bei der landwirtschaftlichen Tierhaltung und bei der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern freigesetzt wird. Die Minderung der NH3-Emissionen ist international …
Mehr lesen...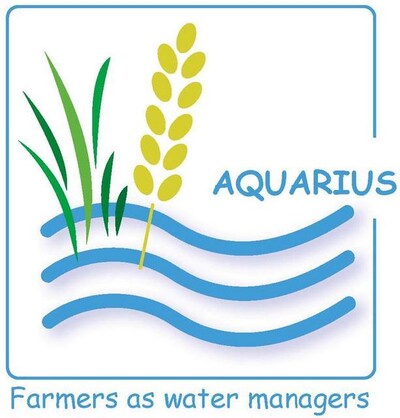
AQUARIUS
Ausgangslage Die Niederschläge in der östlichen Lüneburger Heide sind deutlich niedriger als im übrigen Niedersachsen. Der eigentliche Wasserbedarf der landwirtschaftlichen Kulturen liegt dann oftmals sogar noch über …
Mehr lesen...