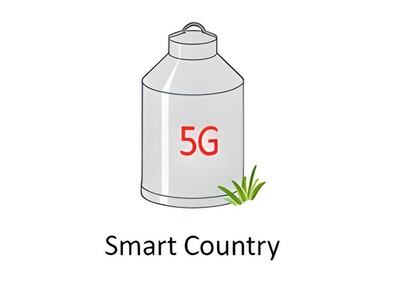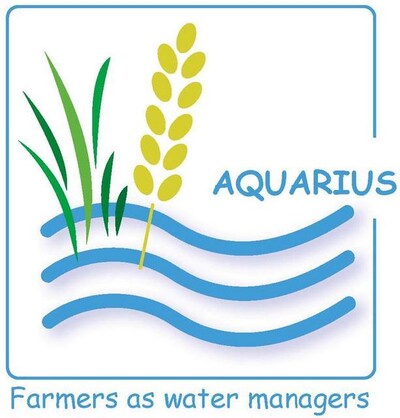Bei hohen Milchleistungen muss die Energiedichte der Futterration deutlich erhöht werden, um die Kühe bedarfsgerecht zu versorgen. Hierzu sind nicht nur gute Grundfutterqualitäten sondern auch deutlich höhere Kraftfutteranteile in den Rationen erforderlich. Mit der Erhöhung des Anteils leicht fermentierbarer Kohlenhydrate steigt aber das Risiko von subklinischen oder sogar klinischen Pansenübersäuerungen (Azidose), die insbesondere in Hochleistungsherden bei ungünstiger Rationszusammensetzung durchaus häufiger anzutreffen sind.
Um den Strukturwert in kraftfutterreichen Rationen zu erhöhen, setzen Milcherzeuger meist Stroh oder zum Teil auch älteres Heu ein. Da die Strohqualität im letzten Jahr nur mäßig und auch das Angebot sehr knapp war, haben im letzten Jahr zahlreiche Milch-viehbetriebe Luzerneheu als Strukturkomponente genutzt. Luzerneheu hat eine ähnlich gute Strukturwirkung wie Stroh, weist aber einen deutlich höheren Rohproteingehalt auf. Dies bestätigte auch eine neuere Untersuchung der LWK Niedersachsen (Meyer, 2012), in der im Mittel von 20 Proben über 16 % Rohprotein in der Trockenmasse analysiert wurden (Stroh im Vergleich ca. 3,5 % RP i. d. TM), wobei die Schwankungsbreite zwischen den Futterproben beachtlich war.
Aus der Praxis wurde über den Einsatz des Luzerneheus recht positiv berichtet, wobei insbesondere die gute Futterakzeptanz und eine höhere Futteraufnahme hervorgehoben wurden. Daher setzen auch heute noch viele Betriebe das Luzerneheu - trotz des hohen Preises - weiterhin als Strukturfutterkomponente in den Milchviehrationen ein.
Fütterungsversuch
Ein Versuch zu der Frage, ob und in welcher Größenordnung sich die Futteraufnahme einer Mischration durch den Einsatz von Luzerneheu im Vergleich zu Stroh als Rationsbestandteil verbessern lässt, wurde Mitte April auf dem „Forum angewandte Forschung in der Rinder- und Schweinehaltung“ in Fulda vorgestellt (Pries u. a., 2013). Dabei wurden vier Futterrationen verglichen, die als Strukturkomponente entweder 1 kg Stroh oder Luzerneheu in unterschiedlichen Mengen (1 kg, 2 kg und 4 kg) enthielten. Da das Luzerneheu höhere Gehalte an Rohprotein (XP) und nutzbarem Rohprotein (nXP) enthält, wurde ein Teil des als Proteinfutter eingesetzten Rapsextraktionsschrotes bei steigendem Luzerneanteil durch energiereiches Milchleistungsfutter ausgetauscht. Alle Rationen wurden so zusammengestellt, dass sie für eine Milchleistung von etwa 35 kg Milch ausreichten. In jeder der vier Fütterungsgruppen wurden zwischen 25 und 31 Kühe mit vergleichbaren Daten hinsichtlich der Tiergewichte, Anzahl Laktationen, Laktationsstadium, aktueller Milchleistung sowie der Vorlaktationsleistung gehalten. Der Versuchszeitraum umfasste insgesamt 100 Laktationstage. Anzumerken ist, dass die Analyse der im Versuch eingesetzten Luzernecharge einen Rohproteingehalt von lediglich 137 g je kg Trockenmasse ergab, was deutlich unter dem deklarierten Wert lag aber auch unter dem in der DLG-Tabelle angegebenen Wert.
Höhere Futteraufnahme
Bei den Energie- und Nährstoffkennzahlen unterschieden sich die Rationen mit Stroh bzw. 1 kg oder 2 kg Luzerneheu nur unwesentlich voneinander. Erst bei einem Anteil von 4 kg Luzerneheu war der Anteil an unbeständiger Stärke und Zucker bzw. an Energie etwas gemindert.
Beim Vergleich der Futter-, Energie- und Nährstoffaufnahme in den vier Versuchsgruppen (s. Tabelle 1) fällt zunächst auf, dass in allen Luzernerationen zwischen 1,2 bis 1,4 kg Trockenmasse mehr gefressen wurde als in der Strohvariante. Damit bestätigten sich die aus der Praxis berichteten positiven Effekte des Luzerneheus auf die Futteraufnahme. Während es bei der Versorgung mit Rohprotein bzw. nutzbarem Rohprotein nur geringe Unterschiede gab, wurden die Kühe insbesondere bei der Ration mit 1 kg Luzerne deutlich besser mit löslichen Kohlehydraten Stärke und Zucker versorgt. Die Gesamtenergieaufnahme war bei allen Luzernerationen im Vergleich zur Strohration erhöht, wobei sich die Unterschiede in den beiden Fütterungsvarianten mit 1 kg bzw. 2 kg Luzerneheu auch statistisch absichern ließen. Rein rechnerisch sollte das Mehr an Energie in diesen beiden Gruppen für etwa 2,4 bis 3,4 Liter Milch ausreichen. Bei der Neutralen Detergenzien-Faser (NDF) als Kennwert zur Beschreibung der Struktur der Rationen stiegen die Werte mit zunehmendem Luzerneanteil erwartungsgemäß an.
|
Futtergruppe |
Stroh |
Luzerneheu |
||
|
1 kg |
1 kg |
2 kg |
4 kg |
|
|
Anzahl Kühe |
30 |
25 |
28 |
31 |
|
Trockenmasseaufnahme kg |
21,7a |
23,1b |
22,9ab |
23,0b |
|
Rohprotein (RP) kg |
3,54 |
3,72 |
3,65 |
3,59 |
|
nutzbares. RP (nXP) kg |
3,48 |
3,67 |
3,59 |
3,50 |
|
unbest. Stärke + Zucker kg |
4,50a |
4,91b |
4,74ab |
4,49a |
|
Neutrale Detergenzien-Faser (NDF) kg |
7,95a |
8,18ab |
8,23ab |
8,48b |
|
Netto-Energie Laktation MJ |
157a |
168b |
165b |
162ab |
|
Fettdruck = signifikante Differenzen p ≤ 0,05 (n. Pries et. al., 2013, verändert) |
||||
Betrachtet man die Leistungsdaten der vier Versuchsgruppen (s. Tabelle 2), dann fallen die generell etwas höheren Milchmengen der Luzerne-Varianten im Vergleich zur Strohration auf. Bei der Ration mit 1 kg Luzerneheu erreichten die Kühe mit 36,2 kg die höchste energiekorrigierte Milchmenge (ECM), was im Vergleich zur Strohgruppe einem Plus von immerhin 3,2 kg Milch entspricht. Mit einer täglichen Eiweißmenge von 1,21 kg erzielte diese Fütterungsgruppe 0,11 kg mehr als die Strohvariante. Beide Differenzen ließen sich statistisch absichern. Die Unterschiede bei den Milchinhaltsstoffen waren bei den ersten drei Fütterungsgruppen eher gering. Die etwas stärkere negative Abweichung bei der Ration mit 4 kg Luzerneheu ließ sich wegen der begrenzten Kuhzahl statistisch nicht absichern.
|
Futtergruppe |
Stroh |
Luzerneheu |
||
|
1 kg |
1 kg |
2 kg |
4 kg |
|
|
Milchmenge kg |
32,9 |
36,0 |
33,3 |
34,1 |
|
Fettgehalt % |
4,06 |
4,01 |
4,11 |
3,84 |
|
Fettmenge kg |
1,32 |
1,45 |
1,37 |
1,32 |
|
Eiweißgehalt % |
3,36 |
3,37 |
3,42 |
3,27 |
|
Eiweißmenge kg |
1,10a |
1,21b |
1,15ab |
1,12ab |
|
Energiekorrigierte Milch kg |
33,0a |
36,2b |
34,0ab |
33,5ab |
|
Fettdruck = signifikante Differenzen p ≤ 0,05 (n. Pries et al., 2013, verändert) |
||||
Fazit
Die Ergebnisse dieses Fütterungsversuches zeigen, dass der Einsatz von Luzerneheu die Futteraufnahme in einer Größenordnung 1,2-1,4 kg Trockenmasse ansteigen lässt. Dies führte zu höheren Milchleistungen, die in der Fütterungsvariante 1 kg Luzerneheu mit einem Plus von 3,2 kg Milch doch beachtlich war. Diese Mehrleistung dürfte auch den deutlich höheren Preis von Luzerneheu im Vergleich zu Stroh rechtfertigen. Zur optimalen Absicherung der Strukturversorgung in den Rationen empfehlen die Versuchsansteller den Einsatz von 1-2 kg Luzerneheu pro Kuh und Tag. Zu beachten ist, dass es beim Luzerneheu deutliche Schwankungen bei den Energie- und Nährstoffgehalten aber auch bei der Partikelgröße gibt. Letzteres ist für die Strukturwirkung des Luzerneheus von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Daher sind Analysen einzelner Lieferpartien für eine optimale Rationsplanung durchaus sinnvoll.