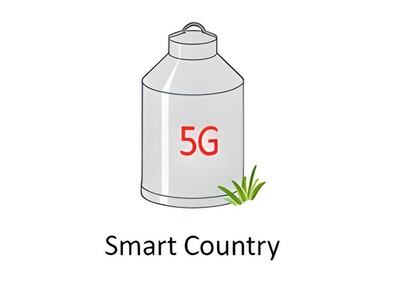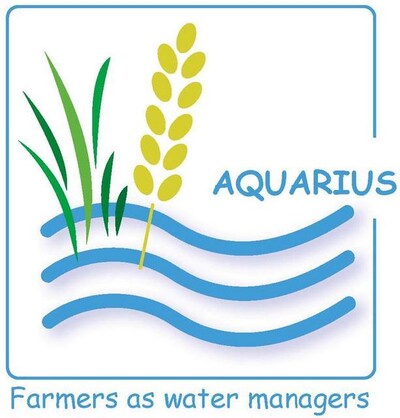Das Frühjahr ist da, die Vegetation hat begonnen und nicht wenige Milchviehhalter öffnen die Stalltore. Bei der Weidefütterung sollten jedoch einige Punkte beachtet werden, damit diese einerseits bedarfsgerecht und andererseits nachhaltig ist.
Wo liegen die Herausforderungen?
Der Bedarf an nutzbarem Rohprotein (nXP) und Energie (NEL) beispielsweise erhöht sich mit steigender Milchleistung deutlich (vgl. Tab. 1). Um den Bedarf decken zu können, müssen die Gehalte in der Ration angepasst werden und die Futteraufnahme der Kühe sich erhöhen. Auch wenn sich die Weidegrasaufnahme nur schwer ermitteln lässt, zeigen verschiedene Studien, dass die Trockenmasseaufnahme an Gras bei Kühen in Vollweide und ohne Kraftfutterzufütterung im Bereich von 18 bis 20 kg/Kuh und Tag liegen kann. Bei unterstellten mittleren Konzentrationen an Energie von 6,5 MJ NEL und an nutzbarem Rohprotein von 150 g/kg Trockenmasse sowie einer Trockenmasseaufnahme von 18 kg/Tag lassen sich Tagesmilchleistungen von etwa 25 kg errechnen. Entsprechend den Nährstoffgehalten im Gras können theoretisch auch höhere und geringere Milchleistungen erreicht werden. In der Praxis werden aber selten höhere Milchleistungen erreicht. Die Ursachen dafür sind unter anderem schwankende Grasaufnahmen der Kühe und die sich ändernden Nährstoffgehalte im Gras.
| Einheit | Milchleistung (4% Fett; 3,4% Eiweiß) | ||||
| unterstellte Trockenmassenaufnahme | kg/Tag | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| Energie (NEL) | MJ/Tag | 121 | 137 | 154 | 170 |
| Energie (NEL) | MJ/kg T | 6,7 | 6,85 | 7,0 | 7,1 |
| nutzbares Rohprotein (nXP) | g/Tag | 2.585 | 3.010 | 3.435 | 3.860 |
| nutzbares Rohprotein (nXP) | g/kg T | 144 | 151 | 156 | 161 |
Die Grasaufnahme je Tag wird von vielen Faktoren, wie beispielsweise der Witterung, Haftwasser am Gras, quantitatives und qualitatives Grasangebot, Kraftfutterzufütterung etc. beeinflusst. Die Quantität und Qualität von Weideaufwüchsen hängen wiederum maßgeblich von der Bestandszusammensetzung, dem Pflegezustand, der Düngung, dem Nutzungszeitpunkt, dem Standort und, wie die letzten Jahre deutlich gezeigt haben, von der Wasserverfügbarkeit ab. Auch wenn junges blattreiches Weidegras von intensiv bewirtschafteten Flächen oftmals Kraftfuttercharakter aufweist, können Energie- und andere Nährstoffgehalte in Abhängigkeit vom Alter des Grases und im Verlauf der Vegetationsperiode deutlich schwanken (vgl. Tab. 2). Darüber hinaus ist anzumerken, dass der zusätzliche Energiebedarf der Kühe für das aktive Grasen und für die erhöhte Bewegungsaktivität schwer abzuschätzen ist und bei Kalkulationen unberücksichtigt bleibt.
Gras hat einen hohen Proteingehalt
Frischgras von intensiv geführten Weiden hat einen hohen Gehalt an Rohprotein (XP) sowie eine hohe Ruminale Stickstoffbilanz (RNB). Dies führt bei einer hohen Grasaufnahme zu einem hohen Stickstoffüberschuss im Pansen. Sofern der Stickstoff dort nicht zu Mikrobenprotein und damit zu nXP umgewandelt werden kann, muss er in der Leber entgiftet und in Form von Harnstoff mit den Körperflüssigkeiten ausgeschieden werden. Eine erste Maßnahme zur Verbesserung der Stickstoffausnutzung wäre die Zufütterung von energiereichen Futtermitteln mit einer negativen RNB (Getreide, Körnermais zuckerarme Melasse- oder Trockenschnitzel, Maissilage). Allerdings sind Futtermittel mit hohen Zucker- und Stärkegehalten und gleichzeitig hoher Pansenabbaurate nur begrenzt einsetzbar. Milchviehrationen sollten nicht mehr als 75 g Zucker und nicht mehr als 250 g Zucker und Stärke in der Trockenmasse enthalten. Da junges Weidegras an sonnigen Tagen durchaus 150 g und mehr Zucker in der Trockenmasse aufweisen kann, ist allein der Richtwert für den Zuckergehalt bereits deutlich überschritten. Darüber hinaus reduziert eine Zufütterung von Kraftfutter die Grasaufnahme und damit die Weideleistung. Auch lässt sich die Stickstoffausnutzung im Pansen nur unwesentlich verbessern wie die Harnstoffgehalte der Milch von einem Praxisbetrieb mit Vollweide zeigen (vgl. Abb. 1). Sofern größere Mengen an Kraftfutter gefüttert werden sollen, ist eine Zufütterung von strukturreichem Grobfutter ratsam. Dies auch, da die Rohfaser des jungen Weidegrases hoch verdaulich ist.
| Aufwuchs | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ø |
| Trockenmasse (T) | g | 186 | 183 | 180 | 176 | 179 | 184 | 188 | 202 | 185 |
| Rohprotein (XP) | g/kg T | 198 | 196 | 214 | 215 | 225 | 225 | 242 | 227 | 218 |
| nutzbares Rohprotein (nXP) | g/kg T | 147 | 146 | 147 | 148 | 149 | 149 | 154 | 155 | 149 |
| Ruminale Stickstoffbilanz (RNB) | g/kg T | 8,2 | 8,1 | 10,8 | 10,8 | 12,2 | 12,2 | 14,1 | 11,4 | 11,0 |
| Rohfaser ( XF) | g/kg T | 190 | 207 | 213 | 209 | 212 | 214 | 190 | 169 | 201 |
| neutrale Detergentienfaser (NDF) | g/kg T | 402 | 426 | 418 | 416 | 423 | 427 | 398 | 366 | 410 |
| Nichtfaserkohlenhydrate (NFC) | g/kg T | 273 | 249 | 236 | 242 | 224 | 220 | 234 | 285 | 245 |
| Netto-Energie-Laktation (NEL) | MJ i. T | 7,04 | 6,83 | 6,3 | 6,36 | 6,37 | 6,35 | 6,53 | 6,63 | 6,6 |
| Phosphor (P) | g/kg T | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,4 | 4,8 |
| Calcium (Ca) | g/kg T | 7,4 | 7,3 | 9,4 | 9,3 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 9,0 | 8,9 |
| Magnesium (Mg) | g/kg T | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 2,9 |
| Kalium (K) | g/kg T | 30,4 | 29,6 | 31,5 | 28,7 | 28,4 | 29,3 | 27,5 | 22,6 | 28,5 |
| Quelle: Steinwidder et al., 2017; geändert | ||||||||||
Fütterungskontrolle mittels Milchinhaltsstoffe
Ein Hinweis über die Versorgungslage des Pansens mit Stickstoff und Energie gibt unter anderem der Harnstoffgehalt in der Milch (vgl. Abb. 1). In Grünlandbetrieben, in denen im Sommerhalbjahr als Grobfutter fast ausschließlich Weidegras zur Verfügung steht, liegen die Milchharnstoffgehalte häufig sehr deutlich über dem empfohlenen Bereich von 150 bis 250 mg/l. Grundsätzlich gilt, je höher der Frischgrasanteil in der Ration ist, desto höher ist der Milchharnstoffgehalt. Je mehr und je gezielter im Stall zugefüttert wird, desto besser kann eine gezielte Rationsergänzung und eine Kontrolle der Futteraufnahme vorgenommen werden. Dies zeigen auch die vergangenen drei Sommer, in denen der Weidegrasaufwuchs des Beispielbetriebes aufgrund der Trockenperioden nicht ausreichte und im Stall zusätzlich Grassilage, gutes Futterstroh und mehr energiereiches Milchleistungsfutter gefüttert wurde.
Darüber hinaus liegen die Proteingehalte in der Grassilage in der Regel unter denen von jungem Weidegras.
Weitere Indikatoren zur Überprüfung der Fütterung sowie der Stoffwechselgesundheit sind die Gehalte an Fett und Eiweiß in der Milch sowie der Fett-Eiweiß-Quotient. Bei der Interpretation des Milchfettgehaltes und des Fett-Eiweiß-Quotienten beispielsweise als Indikatoren zur Beurteilung der Pansengesundheit muss jedoch berücksichtigt werden, dass der Milchfettgehalt mit zunehmendem Anteil an jungem Frischgras in der Ration absinkt und in der Regel niedriger ist als bei Silage - Kraftfutterrationen. Je mehr junges Frischgras die Kühe aufnehmen, desto niedriger ist der Milchfettgehalt. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Gras verhältnismäßig hohe Gehalte an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere an konjugierter Linolsäure (CLA) enthält. Diese Fettsäuren verringern unter anderem den Transport von Fettbausteinen in das Eutergewebe, wodurch der Milchfettgehalt absinkt. Da bei einer subakuten Pansenacidose ebenfalls vermehrt konjugierte Fettsäuren durch die Pansenmikroben gebildet werden, ist es ratsam weitere tierbezogene Indikatoren, wie z.B. Konsistenz, Farbe, Geruch von Kot, Fressverhalten und Pansenfüllungsgrad usw. oder die Wiederkauaktivität mittels Sensoren, zu überprüfen, um keine Fehldiagnosen hinsichtlich der Pansengesundheit zu erzeugen.
Proteingehalt im Milchleistungsfutter reduzieren
Höhere Milchleistungen bedingen auch in einem Grünlandbetrieb die gezielte Zufütterung von Milchleistungsfutter und Silagen oder Heu in der Weidezeit. Dabei sollten die Gehalte an XP, nXP und RNB im Kraftfutter der Fütterungssituation angepasst werden. Um vor allem den nXP-Bedarf bei höheren Leistungen abdecken zu können, sollten die Kraftfutter einerseits Einzelfuttermittel mit einem hohen Energiegehalt und andererseits mit einem hohen Anteil an pansenbeständigem Protein (hoher UDP-Anteil) enthalten. In jungem Weidegras wird lediglich ein UDP-Anteil am XP von 10 % angenommen. Der Anteil an UDP muss aber in Abhängigkeit der Tagesmilchmenge deutlich steigen (vgl. Tab 3).
| Milchleistung | kg/Tag | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| UDP am XP | % | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 |
| Quelle: LFL Bayern, 2019 | ||||||
In Tabelle 4 finden sich die einige ausgewählte Nährstoff- und Energiegehalte möglicher Milchleistungsfutter für die Weideergänzung. Grundsätzlich sollten sie einen möglichst geringen XP-Gehalt, eine deutlich negative RNB und einen möglichst hohen nXP-Gehalt aufweisen. Um den Glukosehaushalt von frischmelkenden Kühen zu unterstützen, sollte auch ein bestimmter Anteil an pansenbeständiger Stärke, beispielsweise aus Körnermais, enthalten sein.
| MLF A | MLF B | ||
| Rohprotein (XP) | g/kg | 140 | 140 |
| nutzbares Rohprotein (nXP) | g/kg | 195 | 180 |
| Ruminale Stickstoffbilanz (RNB) | g/kg | -8,8 | -6,4 |
| Energie (NEL) | MJ/kg | 7,5 | 7,2 |
| Zucker (XZ) | g/kg | 65 | 65 |
| Stärke (XS) | g/kg | 225 | 340 |
| pansenbeständige Stärke | g/kg | 32 | 125 |
In der Praxis ist häufig noch zu beobachten, dass auch in der Vegetationsperiode Milchleistungsfutter mit 160 g/kg oder höheren Gehalten an XP und einer positiven RNB gefüttert werden. Dies ist aber bei hohem Anteil an Frischgras in der Ration nicht erforderlich. Im Gegenteil. Durch Absenkung des Rohproteingehaltes im Milchleistungsfutter lassen sich der Stoffwechsel der Tiere entlasten, überflüssige Stickstoffimporte in den betrieblichen Nährstoffkreislauf verringern, Stickstoffausscheidungen und Emissionen durch die Tiere reduzieren und die Protein- bzw. Stickstoffeffizienz verbessern.