Abschlussbericht zum Pilotprojekt zur Verwertung von Baggergut der Ems auf landwirtschaftlichen Flächen vorgestellt

„Das Pilotprojekt zeigt eindrucksvoll, wie wir durch die Verwendung von überschüssigem Schlick aus der Ems für die ortsnahe Aufhöhung landwirtschaftlicher Flächen eine Win-Win-Situation schaffen können, die der Verbesserung der Ökologie des Ems-Ästuars, der Klimafolgenanpassung und der Flächenbewirtschaftung gleichermaßen zugutekommt und auf die alle Projektbeteiligten gemeinsam hingearbeitet haben“, so der Minister bei seinem Besuch im Emssperrwerk. Rund 50 Gäste, darunter viele Mitarbeitende der Projektpartner aus Niedersachsen und den Niederlanden, waren zur Vorstellung der Projektergebnisse nach Gandersum gekommen. „Wir wollen und müssen den ökologischen Zustand des Ems-Ästuars grenzüberschreitend und in enger Zusammenarbeit mit allen beteiligten Behörden und Verbänden verbessern und uns für die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels wappnen“, betonte Meyer.
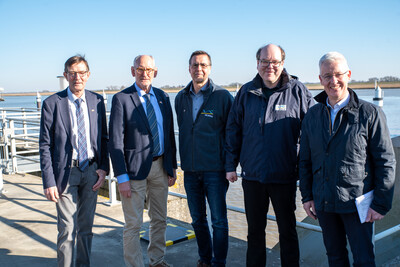
Kooperation mit den Niederlanden
Niedersachsen und die Niederlande haben sich daher in einer im Jahr 2019 unterschriebenen „Ökologischen Strategie zum Sedimentmanagement“ unter anderem das Ziel gesetzt, in der Ems die Schwebstoffkonzentrationen zu reduzieren und die Gewässergüte zu verbessern. Erste positive Ergebnisse zum Thema lieferte bereits die im April 2020 abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Genau dort hat das Pilotprojekt nun angesetzt. Wie die Machbarkeitsstudie wurde auch das Pilotprojekt mittels EU-Mitteln (ELER – Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) gefördert.
Höhere Erträge, mehr Nährstoffe

Dungtellerstreuer und Bagger im Einsatz
Aufgetragen wurde das Baggergut mit Dungtellerstreuern sowie Dumpern und Baggern. Für die Verteilung erwies sich ein Trockensubstanzgehalt von 55 bis 60 Prozent im Schlick als optimal. Anschließend wurde das Baggergut mit Pflug und Kreiselegge, bzw. Fräse, eingearbeitet. Da für die Verteilung die Flächen recht intensiv befahren wurden, mussten Bodenschutzmaßnahmen getroffen werden, um einer nachhaltigen Bodenverdichtung vorzubeugen. Idealerweise wurde das Baggergut auf Getreidestoppeln oder einer kurzen Grasnarbe aufgetragen. Für einen großflächigen Auftrag des Baggerguts auf den Flächen ist der Arbeitsaufwand für die Landwirtinnen und Landwirte mit den erprobten Mitteln jedoch hoch.
Im Projekt ergaben sich aber auch Hürden, die für eine großflächige Aufbringung des Baggerguts auf landwirtschaftliche Flächen noch überwunden werden müssen. Das betrifft naturschutzfachliche Anforderungen, förderrechtliche Vorgaben sowie bodenschutz-, abfall- und düngerechtliche Aspekte. Hier, so das Fazit der Projektbeteiligten, sei die Politik gefragt, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen.
Nutzungserlaubnis für Pressemitteilungen







