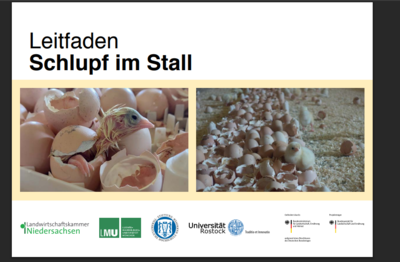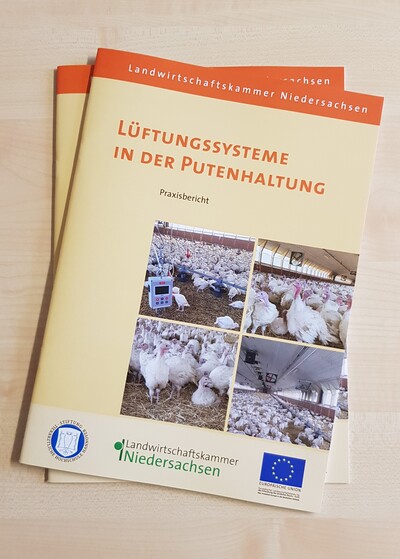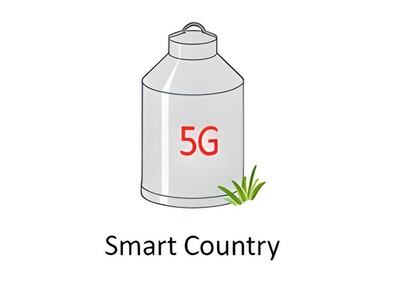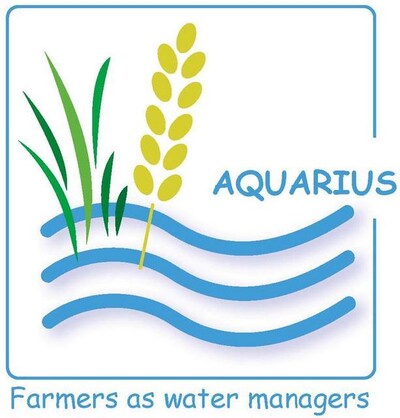Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) führt Ganzkörperanalysen einzelner Nutzgeflügelspezies und Produktionsrichtungen durch. Der dabei erfasste Nährstoffansatz spielt eine maßgebliche Rolle bei der Bilanzierung der Nährstoffausscheidungen. Aus der Nährstoffzufuhr über das Futter abzüglich des Nährstoffansatzes im Tierkörper können die Nährstoffausscheidungen errechnet werden. Eine möglichst realitätsnahe Ermittlung der umweltrelevanten Nährstoffe Stickstoff (N) und Phosphor (P) im Ganzkörper von Geflügelspezies unter Einhaltung einer einheitlichen Standardmethode ist für weitere Ableitungen in der Stoffstrombilanz- und Düngeverordnung essenziell.
Die LWK beabsichtigt, eine standardisierte Methode der Ganzkörperpräparation von Geflügel bundesweit zu etablieren, um mögliche Unterschiede in der Tierkörperaufbereitung und damit in den Analyseergebnissen auszuräumen.
Im DLG-Band 199 „Bilanzierung der Nährstoffausscheidungen landwirtschaftlicher Nutztiere“ (2014) sowie im aktuellen DLG Merkblatt 457 „Berücksichtigung N- und P- reduzierter Fütterungsverfahren bei den Nährstoffausscheidungen von Masthühnern, Jung- und Legehennen“ (2023) werden für Jung- und Legehennen Ansätze von 35 g N und 5,6 g P je kg Ganzkörper kalkuliert. Mit diesen Werten wurden die Nährstoffausscheidungen in der Düngeverordnung berechnet, unberücksichtigt blieben genetische Unterschiede und Abweichungen zwischen Jung- und Legehennenhaltung.
Daher wurde ein Projekt mit drei Junghennenherkünften durchgeführt. Ziel der Arbeit war, unter Berücksichtigung einer einheitlichen Präparationsmethode den Nährstoffansatz der Junghennenherkünfte mit den DLG-Werten zu vergleichen.
Ganzkörper von drei Junghennenherkünften untersucht
Aus zwei Aufzuchtbetrieben der Firma LOHMANN Deutschland GmbH wurden jeweils 15 Junghennen braun-, weiß- und beigelegender Linien entnommen (Lohmann Brown-Classic (LB), Lohmann Selected Leghorn-Classic (LSL) und Lohmann Sandy (S)). Die Junghennen repräsentierten hinsichtlich ihrer Entwicklung das Mittelmaß der jeweiligen Herde. Alle Tiere wurden vierphasig mit einem Alleinfuttermittel für braune Herkünfte versorgt. Je nach Linie lag der Futterverbrauch bis zum 120. Aufzuchttag bei 5,6 - 6,4 kg je Tier.
Um den Nährstoffgehalt der zu Beginn eigestallten Eintagsküken zu berücksichtigen, wurden, wie in früheren Untersuchungen, 40 g pro Tier vom Lebendgewicht abgezogen, um die Berechnung des Nährstoffansatzes um den „Input-Faktor Eintagsküken“ zu bereinigen. Unberücksichtigt blieb die abweichende Zusammensetzung eines Eintagsküken im Vergleich zu einem älteren Tier. Die Junghennen waren bei der Tötung 119 Tage alt, da üblicherweise am 120. Tag die Aufzucht endet und dieser Zeitpunkt damit besonders interessant ist. Die Tötung der Hennen erfolgte nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes und der Tierschutz-Versuchstierverordnung nach Betäubung durch stumpfen Schlag auf den Kopf mittels zervikaler Dislokation und mit zusätzlicher Durchtrennung der halsnahen großen Blutgefäße. Das aus den großen Blutgefäßen ausgetretene Blut koagulierte im Kopf- und Halsbereich, sodass eine separate Aufbereitung des Blutes für die weiteren Präparationsschritte nicht nötig war. Die Federn wurden nach dem Brühen nass gerupft und der Magen- und Darminhalt entfernt. Die Federn wurden getrocknet, zerkleinert, verwogen und nach genetischer Herkunft gepoolt. Die Körper wurden einzeln gemahlen, gefriergetrocknet und anschließend von der LUFA Nord-West auf die Gehalte an N und P analysiert, ebenso die Federproben.
Die Auswertung der Daten aus der Ganzkörperanalyse wurde mit dem Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Statistics Version 27, IBM, Armonk, NY) durchgeführt (p<0,05). Die Auswertung der Gewichte und des Nährstoffansatzes der Junghennen zwischen den Gruppen und innerhalb der Gruppen erfolgte mittels einer ANOVA-Analyse. Für die varianzanalytische Auswertung wurden zunächst die Voraussetzung, insbesondere der Test auf Homogenität, geprüft. Es wurden Tests der Zwischensubjekteffekte und paarweise Vergleiche durchgeführt.
Höhere N- und P-Gehalte
Die Tabelle 1 zeigt die Lebendmasse, die präparierte Körpermasse, das Federgewicht und die in den Federn gemessene N-Menge der drei untersuchten Junghennenherkünfte.
| Genetik | LM (g/Tier) ± SD | KM, präpariert (g/Tier) ± SD | Federmasse (g/Tier) ± SD | N in Federn (g/Tier) ± SD |
|---|---|---|---|---|
| S | 1411 ± 167,7 | 1268 ± 152,5 | 103 ± 17,3 | 14,19 ± 2,4 |
| LB | 1430 ± 114,5 | 1280 ± 102,9 | 108 ± 15,7 | 14,76 ± 2,2 |
| LSL | 1240 ± 83,2 | 1116 ± 78,1 | 89 ± 8,2 | 12,14 ± 1,2 |
| Arith. Mittel | 1360 ± 152,6 | 1221 ± 137,3 | 100 ± 14,7 | 13,70 ± 2,3 |
LM: Lebendmasse; KM: Körpermasse (ohne Magen-/Darminhalt, ohne Federn); S: Lohmann Sandy; LB: Lohmann Brown-Classic; LSL: Lohmann Selected Leghorn-Classic; SD: Standardabweichung der jeweiligen Stichprobe
Die weißlegende Herkunft LSL wies eine deutlich geringere Lebend- und Federmasse je Tier auf als die anderen beiden Herkünfte. Die Differenz zwischen Lebendmasse und präparierter Körpermasse zeigt, dass bei Erfassung der Lebendmasse ein Anteil an Exkremente- und Futterresten von 10 % berücksichtigt werden muss, um auf den für die Berechnung des Nährstoffansatzes relevanten Tierkörper zu schließen. Allein den eiweißreichen Federn (85 % Rohprotein) konnten bis zu 30 % des gesamten N-Ansatzes zugeordnet werden.
Die Tabelle 2 zeigt den Nährstoffansatz der Junghennen, der sich aus der Analyse des Ganzkörpers, der Federn und der Verrechnung mit dem Input-Faktor Eintagsküken ergibt.
| Genetik | N (g/kg) ± SD | P (g/kg) ± SD | K (g/kg) ± SD |
|---|---|---|---|
| S | 36,49a ± 2,1 | 6,44a ± 0,4 | 2,20a ± 0,1 |
| LB | 36,23a ± 1,7 | 6,07b ± 0,5 | 2,18a ± 0,1 |
| LSL | 35,72b ± 1,2 | 6,37a ± 0,5 | 2,10b ± 0,1 |
| Arithmetisches Mittel | 36,15 ± 1,7 | 6,29 ± 0,5 | 2,16 ± 0,1 |
a, b: Verschiedene Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede innerhalb einer Spalte; S: Lohmann Sandy; LB: Lohmann Brown-Classic; LSL: Lohmann Selected Leghorn-Classic; SD: Standardabweichung der jeweiligen Stichprobe
Im Nährstoffansatz der Junghennen wurden teilweise signifikante Unterschiede zwischen den Linien festgestellt: Der N- und K-Ansatz der weißlegenden LSL-Junghennen war geringer als bei den beige- und braunlegenden Linien (S und LB), die sich statistisch nicht voneinander unterschieden. Beim P-Ansatz wurde bei LB weniger P im Ganzkörper ermittelt als bei LSL und S.
Fazit
Ziel der Untersuchung war, den Nährstoffansatz dreier Junghennenherkünfte anhand einer einheitlichen Präparationsmethode zu vergleichen. Die getrennte Analyse von Ganzkörper und Federn zeigte, dass die Federn einen erheblichen Anteil am N-Ansatz der Junghenne haben.
Die ermittelten Ansätze lagen bei N um 3 % und bei P um 11 % über den - auch rechtlich herangezogenen - Werten der DLG. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Nährstoffansatz von Junghennen und Legehennen nicht vergleichbar ist, auch wenn die DLG bislang keine Differenzierung vorsieht. Außerdem konnten teilweise signifikante Unterschiede im Nährstoffansatz zwischen den drei untersuchten Junghennenlinien festgestellt werden, während das DLG- Merkblatt nicht zwischen verschiedenen Genetiken unterscheidet.
Es wäre sinnvoll, verschiedene Legehennen-Herkünfte zu vergleichen, um zu prüfen, ob eine Differenzierung in Junghennenaufzucht und Legehennenhaltung erforderlich ist. Ein standardisiertes Ganzkörperanalyseverfahren mit Junghennen am Ende der Aufzucht und Legehennen könnte dazu beitragen, die Ansatzwerte in der Düngeverordnung zu aktualisieren. So ließen sich zukünftig genauere Nährstoffbilanzen erstellen. Um die Ergebnisse dieser Arbeit zu validieren, müssen weitere Studien zu Ganzkörperanalysen durchgeführt werden.
Literaturangaben
- Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG). 2023. Berücksichtigung N- und P- reduzierter Fütterungsverfahren bei den Nährstoffausscheidungen von Masthühnern, Jung- und Legehennen, DLG Merkblatt 457, 18. DLG-Verlag, Frankfurt am Main.
- BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (BMEL). 2017. Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung - DüV). Bundesgesetzblatt I, S. 1305, zuletzt geändert durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436).
- DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS-GESELLSCHAFT (DLG). 2014. Bilanzierung der Nährstoffausscheidungen landwirtschaftlicher Nutztiere. 2. Auflage. DLG-Verlag, Frankfurt am Main.
- Tierschutzgesetz (TierSchG). 2006. Bundesgesetzblatt I, S. 1206, 1313.
- Tierschutz-Versuchstierverordnung (TierSchVersV). 2013. Bundesgesetzblatt I, S. 3125, 3126, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. August 2021, BGBl. I S. 3570.
Autoren:
Niels Luther-Köhne, Andrea Meyer, Dr. Peter Hiller - Fachbereich 3.7 - Tierzucht, Tierhaltung und Versuchswesen Tier, Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Mareike Kölln, Jeannette Kluess - Institut für Tierernährung (ITE), Friedrich-Loeffler-Institut, Braunschweig
Julia Slama - Institut für Ernährungsphysiologie und Tierernährung, Universität Rostock, Rostock
Robby Andersson - Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Hochschule Osnabrück, Osnabrück