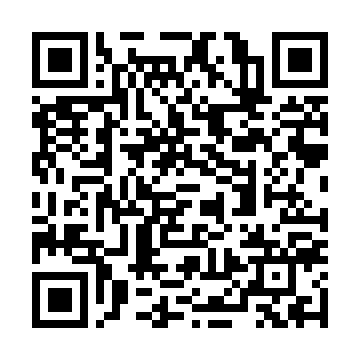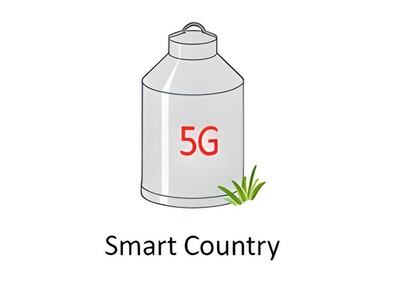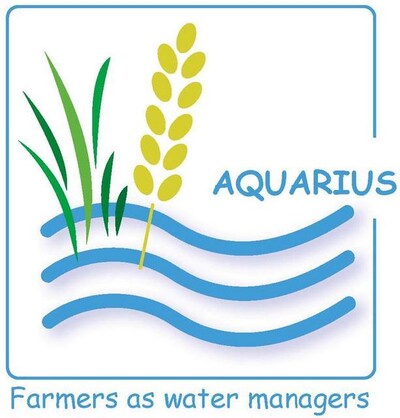Das Welsche und das Deutsche Weidelgras sind wichtige Futtergräser. In qualitativ wertvollen, weil leistungsstarken Qualitätsstandardmischungen des Grünlandes und des Ackerfutterbaues dürfen Weidelgräser als dominanter Bestandteil nicht fehlen. In einigen Ackerbauregionen sind in jüngster Zeit erste Resistenzen des Welschen Weidelgrases beobachtet wurden. Es wird in dem Zusammenhang als Ungras eingestuft. Wie man die Aussagen einstufen soll und vor allem, wie im Ackerbau darauf zu reagieren ist, lesen Sie nachfolgend.
Der Einsatz des Welschen Weidelgrases wird in jüngster Zeit im Ackerbau zwiespätig gesehen. Teilweise wird es gar als Ungras eingestuft. Diese Abwertung schmerzt nicht nur Futterbauern, sondern auch Gräserzüchter, Grassaatgutmischer sowie Grünland- und Futterbauberater. Eine sachdienliche Betrachtung ist angebracht. Vor allem erscheint es wichtig, gezielte Hinweise zum Umgang des Welschen Weidelgrases im reinen Ackerbau zu geben.

Für Ackerfutterbauern hat das Welsche Weidelgras den höchsten Stellenwert. Es wird nicht nur als ertragreichstes Futtergras geschätzt, sondern auch wegen des guten Futterwertes sowie den vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten zur Silierung, Frischfütterung und Beweidung. Das Welsche Weidelgras hat nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine hohe Anbaubedeutung. Man könnte gar soweit gehen, zu sagen: Was für den Ackerbauern der Weizen, ist für den Ackerfutterbauern das Welsche Weidelgras.
Auch vor dem Hintergrund der Futterproduktion im Klimawandel punktet das Welsche Weidelgras. Es schöpft sehr viel Ertrag aus der Winterfeuchtigkeit, wächst rasch und massereich im Frühjahr. Daher findet das Welsche Weidelgras als Winterzwischenfrucht eine häufige Verwendung. Im Hauptfruchtbau sind im Allgemeinen bis Juni bereits zwei Drittel des möglichen Jahresertrages erzielt. Es kann damit in aller Regel viel Futter vor den möglichen Sommertrockenheiten liefern und die Futterproduktion absichern.
Als weiterer Pluspunkt ist der hohe Nährstoffentzug des leistungsstarken Grases zu sehen. Bei hoher Nutzungsintensität und Ertragsleistungen von ca. 150 dt TM/ha liegen die Stickstoffentzüge bei etwa 500 kg N/ha und die Kalium-Entzüge bei etwa 450 kg/ha. Diese Eigenschaft in Verbindung mit der intensiven Durchwurzelung ist vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Düngegesetzgebung ein großer Vorteil bei der Gestaltung umweltgerechter Nutzungssysteme.
Weidelgräser im Ackerbau
Der reine Ackerbaubetrieb benötigt das Welsche Weidelgras nicht als Futtergras. Der Anbau des Welschen oder auch Deutschen Weidelgrases erfolgt zur Saatgutvermehrung, als gezielte Begrünung im Rahmen von Bracheflächen, als Pufferstreifen entlang von Wasserläufen oder als Untersaat zum Zwecke des Erosionsschutzes und der ganzjährig gezielten Begrünung. Der Anbauzweck dient damit ganz häufig dazu, den Rahmenbedingungen guter landwirtschaftlicher und ökologischer Bewirtschaftung (GLÖZ-Maßnahmen) zu entsprechen. Im Allgemeinen werden hierfür Grasmischungen verwendet, die u.a. neben den Weidelgräsern, auch andere Grasarten sowie Leguminosen und Kräuter enthalten. Da die stillgelegten Flächen in dem Zeitraum ab 01. April bis 15. August nicht gemulcht und gewalzt werden dürfen, ist ein Aussamen der Kulturen die Folge. Die schnell wachsenden Weidelgräser, allen voran das Welsche Weidelgras, erlangt in dem Zeitraum unausweichlich die Samenreife. Es kann daher in der Folgefrucht als unerwünschter Fremdbesatz auftreten. Daher wird bei der Auswahl von einjährigen Begrünungsmischungen empfohlen, auf die Integration von Weidelgras zu verzichten.
In einigen Regionen Deutschlands treten erste Resistenzen des Welschen Weidelgrases gegenüber verschiedenen Herbizid Wirkstoffklassen auf und stellen die Praxis besonders in intensiven Ackerbaufruchtfolgen vor Probleme. Weiterhin sind viele Wirkstoffe nicht mehr zugelassen. Mittelfristig ist zudem eine weitere Verringerung des Herbizidportfolios zu erwarten.
Im Allgemeinen wird der Erfolg des Herbizid Einsatzes auf der Fläche anhand des Eindämmungsgrades der zu behandelnden Ungräser und Unkräuter bewertet. Natürlich vorkommende genetische Abweichungen, sogenannte Mutationen, können bei Einzelpflanzen der Population dazu führen, dass die Herbizid Anwendung überlebt wird. Diese Individuen werden durch wiederholte Herbizid Anwendungen mit dem gleichen Wirkmechanismus immer weiter heraus selektiert, sodass der Anteil resistenter Individuen in der Population steigt und sich eine Resistenz aufbaut. Wie schnell diese Prozesse ablaufen, ist von Kultur zu Kultur und je nach Herbizid Management des Betriebes unterschiedlich. Das Welsche Weidelgras kann bereits nach vier Behandlungen vollständig resistent sein. Auch dem Deutschen Weidelgras wird eine rasche Resistenzbildung bescheinigt, doch kommt diese nicht mit der Schnelligkeit des Welschen Weidelgrases mit.
Wichtig ist zu wissen, dass die Resistenzen in aller Regel erst auf dem Feld entstehen und nicht schon mit der Sackware gekauft werden. Die Schlussfolgerung muss also lauten, den Herbizideinsatz zur Bekämpfung von Weidelgräsern in einer Hauptfrucht so zu gestalten, dass maximale Wirkungsgrade bei möglichst geringer Anwendungshäufigkeit erzielt werden. In dem Zusammenhang kommen den vorbeugenden Maßnahmen wie Fruchtfolge, Saatzeit und der mechanischen Pflegearbeit ein hoher Stellenwert zu, ähnlich wie im ökologischen Landbau, der gänzlich auf chemischen Pflanzenschutz verzichten muss. An dieser Stelle sei auf Abbildung 1 des Pflanzenschutzdienstes unseres Hauses verwiesen.
Acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen
Aus der Abbildung 1 „Unkrautregulierung und Anti-Resistenzmanagement“ wird deutlich, dass beim Anbau von Drusch-, Öl- und Hackfrüchten der Weidelgraskontrolle mehr Aufmerksamkeit zu schenken ist und hierbei vor allem acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen zu nutzen sind, die nachfolgend beispielhaft aufgeführt werden.
Die Fruchtfolge zu erweitern sowie den Zwischenfruchtanbau zu integrieren, kann hierbei eine von mehreren, möglichen Maßnahmen sein. Mit Hilfe einer mehrfachen Stoppelbearbeitung lassen sich sowohl Altpflanzen als auch jung gekeimte Pflanzen zerstören.
Anstatt der Minimalbodenbearbeitung kann vor allem in Gebieten mit bestehender Herbizidresistenz eine gezielte Pflugfurche im Rahmen der Fruchtfolge das Problem lindern, da das Samenpotential vergraben wird.
Prinzipiell ist viel Wert auf ein gut hergerichtetes Saatbett zu legen, um der anzubauenden Kultur gute Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Vor allem bei Wintergetreide haben sich spätere Saattermine in der Praxis bewährt, denn in dem Zeitraum sind Keimungsraten und Wachstumsgeschwindigkeit des Welschen Weidelgrases vermindert. Gleichfalls bekommt die Feldhygiene zunehmende Bedeutung. Die Reinigung von Mähdreschern vor dem Umsetzen auf benachbarte Felder ist zwar mit Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Doch lohnt sich diese Arbeit, da wirkungsvoll der Verschleppung von Samen Herbizid resistenter Unkräuter und Ungräser vorgebeugt werden kann.
Ein Mulchen der Feldränder verhindert die Ausbreitung vor Samenbildung. Aktiv und zur Futternutzung begrünte Gewässerrand- bzw. Pufferstreifen sind rechtzeitig zu ernten. Wo das beispielsweise auf Grund von Verbotszeiträumen nicht gewährleistet werden kann, sollte auf die Einbindung von Welschem und Deutschem Weidelgras in einjährigen Begrünungsmischungen verzichtet werden.
Falls Weidelgräser als unerwünschtes Gras auf Ackerflächen stark überhandgenommen haben, ist es auch eine Überlegung wert, ob dem Problem durch gezielten Anbau von Welschem Weidelgras zum Zwecke der intensiven Futternutzung begegnet werden kann. Weitere Informationen dazu gibt Kasten 1.
Dem Fremdbesatz des Welschen Weidelgrases mit gezieltem Anbau von Welschem Weidelgras begegnen
Unerwünschtes Weidelgras durch gezielten Anbau von Welschem Weidelgras mit beispielsweise der Ackerfuttermischung A1 zu begegnen, erscheint für den ersten Moment verwirrend. Dennoch kann es dort eine Strategie sein, wo das Welsche Weidelgras zu Futterzwecken genutzt werden kann und eine intensive Schnittnutzung zu Beginn des Ährenschiebens erfolgt. Wichtig ist, dass ein später Schnitt und somit die Samenbildung zu jedem Aufwuchs vermieden wird. So lässt sich innerhalb eines Jahres der Durchwuchs jenes Weidelgrases der Vorkultur eindämmen. Wird gar eine überjährige Nutzung des Welschen Weidelgrases eingeplant, so geht auch die Triebkraft des bewusst ausgedrillten Weidelgrases zurück, was die Bekämpfungsstrategien im Rahmen der Nachfrucht erleichtert. Stets frühe Nutzungen vorausgesetzt, kann auch mit mehrjährigen Gras- oder Kleegrasmischungen dem Fremdbesatz an Welschem Weidelgras begegnet werden, denn das Welsche Weidelgras büßt bereits ab dem zweiten Nutzungsjahr deutlich an Triebkraft ein.
Wie kann die Politik helfen?
- Zum Schutz der Umwelt und des Klimas sowie zur Förderung der Biodiversität sind eine ganze Reihe an rechtlichen Regelungen für die landwirtschaftliche Praxis auf den Weg gebracht.
- Die Politik hat die Vereinbarkeit der unterschiedlichen Schutzziele zu begleiten und ggf. dann nachzubessern, wenn bessere Lösungsansätze erforderlich sind.
- Im Hinblick auf den Umweltstandard „Mindestanteil von nicht produktiven Flächen“ (GLÖZ 8) wäre die frühere oder gar regelmäßige Pflege der stillgelegten Flächen hilfreich. Nicht nur im Falle des Weidelgrases kann damit ein Aussamen vermieden werden, sondern auch für andere Pflanzen.
- Ein vermindertes Samenpotential reduziert in der Folgefrucht den Aufwand an Pflanzenschutzmitteln. Der Reduktionsstrategie von Pflanzenschutzmitteln könnte noch besser nachgekommen werden.
Wir fassen zusammen
- Welsches Weidelgras hat im Ackerfutterbau eine hohe Anbaubedeutung und punktet durch ein hohes Ertragspotential, Futterqualität und hohe Nährstoffentzüge.
- Der Durchwuchs des Welschen Weidelgrases im Ackerbau ergibt sich durch das vorangegangene Aussamen des Grases, oftmals bedingt durch Auflagen, die erst eine späte Nutzung erlauben.
- Das Welsche Weidelgras hat die Eigenschaft, schnell Resistenzen aufzubauen.
- Dem Fremdbesatz des Weidelgrases in Ackerbaukulturen sollte in erster Linie mit frühzeitigen ackerbaulichen Maßnahmen begegnet werden.
- Bei Herbizid Anwendung ist auf günstige Behandlungsbedingungen mit wirkungsvollen Mitteln besonders zu achten.