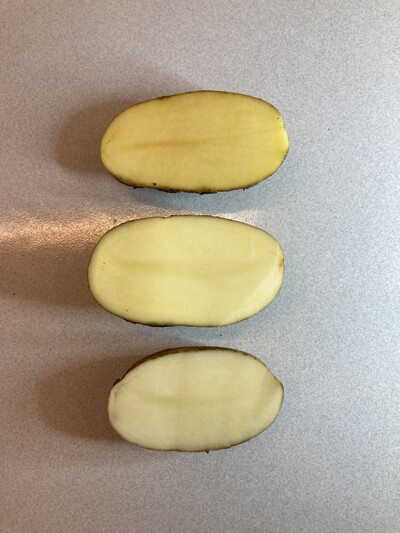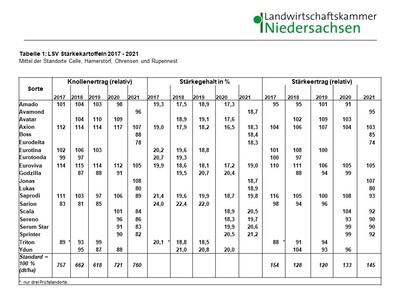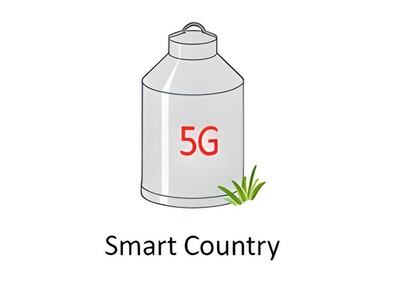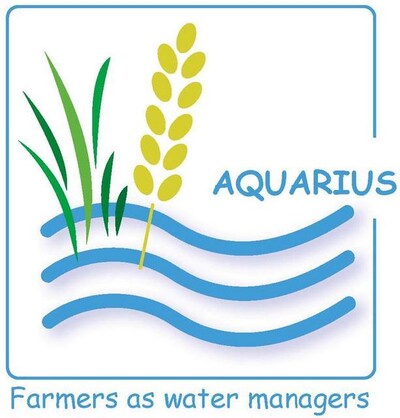Das vergangene Frühjahr wird vielen Kartoffelanbauern in Erinnerung bleiben: In Folge einer geringer ausgefallenen Vermehrungsfläche und deutlich erhöhter Aberkennungs- und Abstufungsraten kam es zu einem Engpass bei der Versorgung mit Kartoffelpflanzgut. Durch die witterungsbedingt oftmals recht grob fallende Sortierung wurde das Angebot zusätzlich verknappt. Vielfach musste daher auf alternativ verfügbare Sorten, eigenen Nachbau oder geschnittenes Pflanzgut zurückgegriffen werden.
Um die gute Nachricht vorweg zu nehmen: Im Anbaujahr 2024 konnte eine moderate Erweiterung der Vermehrungsflächen festgestellt werden, sodass, trotz weiter vergleichsweise hoher Aberkennungsraten, mit einer nicht ganz so angespannten Versorgungssituation gerechnet werden kann. Nichtsdestotrotz ist Pflanzgut vieler bedeutsamer Sorten wieder frühzeitig ausdisponiert, sodass auf Alternativsorten ausgewichen werden muss. Auch das im Frühjahr 2024 vielfach praktizierte Schneiden von Pflanzgut wird in der anstehenden Legesaison wieder genutzt werden: Handelshäuser, Lohnunternehmer und teilweise auch Landwirte haben in Schneidemaschinen investiert und wollen/müssen diese nun auch zum Einsatz bringen. Dabei ist zu bedenken, dass es in der abgelaufenen Saison zwar vielfach Beispiele für erfolgreich aus geschnittenem Pflanzgut erwachsene Partien gab, auf der anderen Seite jedoch auch Partien komplett umgebrochen werden mussten oder erhebliche Fehlstellen im Aufgang zeigten. Soll geschnittenes Pflanzgut zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten, dass nur geeignete Sorten und Partien geschnitten werden: Genau wie verschiedene Sorten unterschiedlich auf Keimabbruch vor oder beim Legen reagieren, ist auch die Reaktion auf das Schneiden von Pflanzgut unterschiedlich, sodass im Vorfeld sortenspezifische Informationen beim Züchter eingeholt werden sollten. 
In der Versuchsstation Dethlingen wurde in der abgelaufenen Vegetationsperiode eine Versuchsanstellung zum Vergleich geschnittenen und ungeschnittenen Pflanzgutes angelegt, in der in vier Sorten der Frage des optimalen Legeabstandes beim Einsatz von geschnittenem Pflanzgut nachgegangen werden soll. In dem Versuch erfolgte die Auspflanzung der geschnittenen Knollen auf einen Legeabstand von 30 cm, während die ungeschnitten Knollen auf 35 cm abgelegt wurden. Durch Auszählung der gebildeten Stängel und Tochterknollen kann auf den optimalen Legeabstand zurückgerechnet werden. Die bislang einjährig vorliegenden Ergebnisse lassen darauf schließen, dass das geschnittene Pflanzgut etwa 30 bis 40 % enger gelegt werden sollte, als das ungeschnittene.
In Folge dieser engeren Ablage erhöht sich die Anzahl der Pflanzstellen um 40 bis 60 %. Dies führt dazu, dass bei einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung in drei von vier Fällen der Einsatz ungeschnittener Pflanzware vorteilhafter ist. Noch nicht berücksichtig ist in dieser Betrachtung das beim Einsatz von geschnittenem Pflanzgut eingegangene Risiko: So zeigten im Versuch alle geschnittenen Varianten einen verlangsamten Feldaufgang. Drei der vier Sorten wiesen geschnitten eine größere Anzahl schwarzbeiniger Stauden auf.
Das Schneiden von Pflanzgut ist aus phytosanitärer Sicht somit die zuletzt zu wählende Option zur Verbesserung der Pflanzgutausbeute und sollte im Regelfall erst dann genutzt werden, wenn keine anderen Alternativpartien oder-sorten verfügbar und pflanzenbauliche Maßnahmen ausgeschöpft sind.
Ist das Pflanzgut knapp, kann zunächst durch die Wahl eines größeren Legeabstandes die „Reichweite“ vergrößert werden. Dies ist allerdings nur in gewissen Grenzen möglich, sodass in der Praxis eine Orientierung an den oberen Werten der Empfehlungen der Spanne der Legeabstände möglich ist. Eine darüberhinausgehende Vergrößerung der Legeabstände kann schnell zu einer ungewollt groben Sortierung des Erntegutes und ungleichmäßigen Beständen führen. Um die Pflanzgutausbeute bezogen auf die Rohware zu erhöhen, erfolgt vielfach eine Anpassung der Sortiergrenzen. Auf diese Weise können auch die in Normaljahren als Unter- sowie Übergrößen abgängigen Anteile der Pflanzgutpartien zur Auspflanzung kommen. Partien mit breiter Streuung der Sortierung sollten in jedem Fall gebrochen, d. h. in Chargen mit größeren und kleineren Knollen aufgeteilt werden. Sollen Untergrößen gepflanzt werden, müssen entsprechend geringere Legeabstände gewählt werden, um die verringerte Anzahl an Trieben je Knolle bei kleinen Knollen zu berücksichtigen. Zudem verfügen Untergrößen über eine verringerte Triebkraft, sodass das Abkeimen vor der Pflanzung in Folge ungünstiger Lagerungsbedingungen des Pflanzgutes unbedingt vermieden werden sollte. Die Legetiefe ist entsprechend zu verringern. Ebenfalls unter Berücksichtigung der Triebkraft sollte die Pflanzung erst bei ausreichend erwärmtem Boden erfolgen. Die Pflanzung mit Legedamm und zeitverzögertem Aufbau des Enddamms kann hier die Erwärmung des Bodens und den Aufgang fördern. Kommen dagegen Übergrößen zur Auspflanzung, können tendenziell größere Legeabstände gewählt werden. Zu bedenken ist allerdings auch, dass bei der Verwendung von Übergrößen schnell große Tonnagen an Pflanzgut je Hektar notwendig werden, die einerseits logistische Herausforderungen darstellen, andererseits aber auch die Pflanzgutkosten je Hektar beeinflussen, sodass die Wirtschaftlichkeit in einzelnen Fällen in Frage gestellt sein kann. Zudem sollte bei der Verwendung von Übergrößen geprüft werden, wie sicher diese mit Becherlegemaschinen geschöpft werden können. Kommt es hier zu einem vermehrten Auftreten von Fehlstellen, wirken sich diese auf Grund des großen Legeabstandes besonders stark aus. Bis zu einem gewissen Grad kann durch den Wechsel auf ein Becherband mit größeren Bechern auf die Knollengröße reagiert werden. Sicherer lassen sich Übergrößen jedoch mit Riemenlegemaschine pflanzen.
Zur Vorbereitung der Anbauflächen sollte der Boden bis in Bearbeitungstiefe ausreichend abgetrocknet sein. Wird dagegen zu früh mit der Bearbeitung begonnen, können Bodenverdichtungen und Strukturschäden das Wurzelwachstum erheblich einschränken und zu einer verminderten Durchlüftung sowie Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit führen. Insbesondere auf Böden mit höheren Schluff- und Tonanteilen kann es zudem zur Bildung von Kluten kommen, welche bis zur Ernte überdauern können. In der Ernte und Einlagerung stellen Kluten und die eingesetzten Verfahren zur Klutentrennung ein wesentliches Beschädigungsrisiko für die Ernteware dar. Wenn Bodenbearbeitung und Pflanzung in getrennten Arbeitsschritten ausgeführt werden, kann die Abtrocknung und Erwärmung der Fläche durch einen flachen Bearbeitungsgang, beispielsweise mit Scheiben- oder Federzinkenegge, gefördert werden. Auch das frühzeitige Zerkleinern eines Zwischenfruchtaufwuchses kann neben der Förderung der zügigen Umsetzung der organischen Masse und der Verfügbarkeit der gebundenen Nährstoffe für die Folgekultur, zu einer Erwärmung des Bodens beitragen. Sollen dagegen Bodenbearbeitung und Pflanzung in einem Arbeitsgang erledigt werden, ist darauf zu achten, dass der Boden bis in die Bearbeitungstiefe von 20 -25 cm ausreichend abgetrocknet ist. Gleiches gilt für den Fall, wenn eine Entsteinung oder Beetseparierung vorgesehen ist, da die Absiebleistung der zur Entsteinung eingesetzten Maschinen unter feuchten Bodenbedingungen deutlich abnimmt. Ein „Zustreichen“ der Oberfläche durch den Einsatz von Dammformblechen unter feuchten Bodenbedingungen beim Legen ist unbedingt zu vermeiden, da hierdurch der Luftaustausch des Bodens beeinträchtigt und der Aufgang deutlich verzögert werden kann.
Insgesamt bleibt die Kartoffel die, sowohl ackerbaulich als auch ökonomisch, vielleicht anspruchsvollste, aber wahrscheinlich auch interessanteste Kultur in unserem Ackerbau. Der Anbau sollte daher in der Fruchtfolge langfristig geplant sein, sodass Pflanzung und vorbereitende Arbeiten der Kartoffel einen optimalen Start in die Vegetation ermöglichen. Das Ziel muss daher sein, das verfügbare Pflanzgut, unabhängig davon ob Normal- oder Sondersortierung bzw. geschnitten oder nicht, unter möglichst optimalen Boden- und Witterungsbedingungen in die Erde zu bringen um so die Grundlage für eine erfolgreiche Saison 2025 zu legen.